Sonntag, 19. August 2018
Uwe Schütte (Hrsg.): Mensch – Maschinen – Musik“
thenoise, 13:44h
 Als Kraftwerk 2012 ins New Yorker Museum of Modern Art (Moma) eingeladen wurde, konnte man durchaus unken, dass die deutsche Band damit endgültig museal sei – und folglich auch ein Fall für das Archiv. Tatsächlich möchte man die Arbeitsmaterialien und Requisiten der Band so wenig dem Verfall preisgeben wie die Manuskripte von Franz Kafka. Und bei der Präsentation im Museum ist die Form der Darstellung entscheidend. Ralf Hütter als in der Band verbliebener Gründer (das zweite Gründungsmitglied Florian Schneider ist 2009 ausgeschieden) hatte nämlich schon im Jahr vor den Moma-Auftritten mit der 3D-Videonistallation im Münchner Lenbachhaus deutlich gemacht, dass er Kraftwerk nicht in den Archiven verstauben lassen, sondern mit neuen Ansätzen lebendig halten möchte.
Als Kraftwerk 2012 ins New Yorker Museum of Modern Art (Moma) eingeladen wurde, konnte man durchaus unken, dass die deutsche Band damit endgültig museal sei – und folglich auch ein Fall für das Archiv. Tatsächlich möchte man die Arbeitsmaterialien und Requisiten der Band so wenig dem Verfall preisgeben wie die Manuskripte von Franz Kafka. Und bei der Präsentation im Museum ist die Form der Darstellung entscheidend. Ralf Hütter als in der Band verbliebener Gründer (das zweite Gründungsmitglied Florian Schneider ist 2009 ausgeschieden) hatte nämlich schon im Jahr vor den Moma-Auftritten mit der 3D-Videonistallation im Münchner Lenbachhaus deutlich gemacht, dass er Kraftwerk nicht in den Archiven verstauben lassen, sondern mit neuen Ansätzen lebendig halten möchte.Die Moma-Konzertreihe wurde in Museen anderer Länder wiederholt. Der Literaturwissenschaftler und Musikjournalist Uwe Schütte initiierte 2015 in Birmingham und Düsseldorf (im Umfeld der Konzerte in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen) wissenschaftliche Konferenzen und legt nun eine umfassende Bestandsaufnahme zum – wie es im Untertitel heißt – «Gesamtkunstwerk Kraftwerk» vor. Er geht dabei chronologisch vor und lässt seine Gastautoren Aspekte der jeweiligen Phasen beziehungsweise Alben beleuchten. Das reicht vom Frühwerk im Krautrock-Kontext über die einzelnen Alben («Autobahn», «Radio-Aktivität», etc.) bis hin zum «Katalog-Komplex», der Zusammenfassung der acht Kraftwerk-Alben (2009) und zur späteren 3D-Retrospektive (2012). In einem zweiten, «Diskurse» genannten Teil dieser «Kraftwerkstudien» geht der Band Themen wie den Texten der Gruppe, ihren Sound-Topographien oder der internationalen Ausstrahlung auf den Grund.
Die in «Mensch – Maschinen – Musik» präsentierten Themen sind naheliegend. Die Texte erheben wissenschaftlichen Anspruch, sind dabei jedoch überwiegend so geschrieben, dass auch interessierte Nicht-Akademiker nur gelegentlich Wortbedeutungen nachschlagen müssen. Ohnehin sind nicht alle Analytiker dem akademischen Ansatz verpflichtet. (Ja, Analytiker: Die Kraftwerk-Analyse ist fest in männlicher Hand, nur zwei von 15 Texten stammen von Frauen.) Der Sammelband ist auf die Würdigung der deutschen Elektroniker angelegt. So mancher Text legt nahe, dass kritische Punkte ausgeblendet wurden. Der Schriftsteller und Journalist Enno Stahl wählt gleich den vertrauten journalistischen Ansatz und führt in seinen Text zum Album «Tour de France» ungeachtet des mangelnden Erkenntnisgewinns damit ein, dass er wegen einer Hüftarthrose zwar wie Ralph Hütter Fahrrad fährt, jedoch nur Mountainbike. Dass es auch besser geht, zeigt Ulrich Adelt. Der Dozent für amerikanische Literatur und Autor eines Buches über Krautrock verdeutlicht, dass Kraftwerks Frühwerk eine «Geschichte des gezielten Vergessens» ist, um den Mythos zu pflegen, dass die Band mit «Autobahn» (1974) aus dem Nichts gekommen sei. Und Eckhard Schumacher, Germanist mit Arbeitsschwerpunkt Gegenwartsliteratur und Pop, weist darauf hin, dass man die Kraftwerk-Geschichte der 80er-Jahre zwar als Erfolgsgeschichte lesen kann – die Gruppe aber nach mit den Alben «Autobahn» und «Computerwelt» den Zenit überschritten hatte und «es danach eher bergab ging». Dafür wurde in dieser Phase die Flamme, die Kraftwerk in den 70er-Jahren entzündet hatten, von anderen weitergetragen – indem sich die New Romantics diesseits und Afrika Bambaataa jenseits des Atlantiks auf das deutsche Quartett bezogen.
Ob beabsichtigt oder nicht: Jede Auseinandersetzung mit der Band, jeder Beitrag zum Thema Kraftwerk – nicht nur in diesem Band – fördert die Mythologisierung der Gruppe. Beiträge, in denen der Fan spricht, werden eher eine kürzere Halbwertszeit haben als solche, die aus einer objektiveren Perspektive verfasst wurden. Doch darf man die Heterogenität der Texte als willkommene Abwechslung deuten – und als Ganzes betrachtet ermöglicht diese Bestandsaufnahme Kraftwerk-Eleven einen umfassenden Einstieg und Kennern eine fundierte Vertiefung mancher Aspekte der Band, die seit einigen Jahren viel unternimmt, um über den sicheren Platz im musikalischen Kanon hinaus ein fester Bestandteil der Kunstwelt zu werden.
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 16. Mai 2018
Michael Hugentobler – Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte
thenoise, 10:26h
Fake-News sind keine neue Erfindung, wie der Schweizer Autor Michael Hugentobler mit seinem Romandebüt zeigt. In "Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte" schreibt er die wahre Geschichte seines Landsmanns Henri Louis Grin neu. Er macht das genauso phantastisch, absurd und erdichtet wie das Original.
Der Ausgangspunkt für Michael Hugentoblers Roman ist die wahre Geschichte eines armen Schweizers: Henri Louis Grin wanderte als sechzehnjähriger nach England aus – als Diener einer durch die Schweiz reisenden britischen Schauspielerin. Später diente er einem Schweizer Bankier in London, bis er als Butler des Gouverneurs von West-Australien mit nach Perth umzog. Er versuchte sich in allen möglichen Bereichen, schlug sich als Kellner, Verkäufer und Porträtmaler durch, versuchte sich als Erfinder und wollte als Perlenfischer ein Vermögen auf dem Meeresgrund finden – er scheiterte immer.
Erst als Geschichtenerzähler vermochte er zu reüssieren. Da war er bereits fünfzig und als Deckschrubber auf einem Dampfschiff wieder zurück nach London gekommen. Allerdings folgte er nicht dem Rat, seine Phantastereien als Roman herauszugeben. Er verkaufte sie lieber als seine eigenen Erlebnisse. Als wollte er Karl May in den Schatten stellen, erzählte er von seinem Leben bei den australischen Aborigines, die ihn zum Häuptling erkoren hätten, er habe Schildkröten geritten und fliegende Wombats gesehen. Er berichtete von Straßen aus Gold in Guinea, und dass er in kürzester Zeit beliebige Sprachen lernen könne. Seine Phantastereien konnte er sogar der Royal Geographical Society präsentieren.
Michael Hugentobler hat aus dieser außergewöhnlichen Lebensgeschichte einen herrlichen Roman gemacht, süffig zu lesen, voller Witz und Ironie. Und am Ende ist man sich nicht mehr sicher, ob man auf seinen Louis nicht doch auch hereinfallen würde.
Bei ihm ist es ein Hans Roth, der 1849 in einem Schweizer Bergdorf geboren wurde, schon aus jugendlicher auswanderte, durch die Welt reiste und sich eines Tages den Namen Louis de Montesanto gab. Er behauptete in Paris aufgewachsen zu sein und erzählt auch sonst jede Menge unglaubwürdiger Geschichten.
Es ist nur folgerichtig, dass Michael Hugentobler der wahre Lügengeschichte seines Landsmanns genauso fantastisch schweifen lässt wie sein Vorbild. Dessen Geschichte erfindet er nicht nur neu. Er spinnt sie weiter, indem er seine Tochter Old Lady Long in einem zweiten Erzählstrang auf die Suche nach dem Grab ihres Vaters schickt und sie in einem mit Efeu überwachsenen Haus auf ihren Bruder treffen lässt, das zweite Kind von Louis de Montesanto.
«Truth is stranger than fiction, but De Rougemont is stranger than both», hat das Wide World Magazine im Juni 1899 über den sensationellen Schwindler geschrieben. Die Wahrheit sei bizarrer als die Fiktion, aber De Rougemont noch seltsamer als beide – das möchte man seinem ehrlichen Nachfahren Michael Hugentobler nicht nachsagen. Aber als Erzähler ist er ebenso fulminant.
Der Ausgangspunkt für Michael Hugentoblers Roman ist die wahre Geschichte eines armen Schweizers: Henri Louis Grin wanderte als sechzehnjähriger nach England aus – als Diener einer durch die Schweiz reisenden britischen Schauspielerin. Später diente er einem Schweizer Bankier in London, bis er als Butler des Gouverneurs von West-Australien mit nach Perth umzog. Er versuchte sich in allen möglichen Bereichen, schlug sich als Kellner, Verkäufer und Porträtmaler durch, versuchte sich als Erfinder und wollte als Perlenfischer ein Vermögen auf dem Meeresgrund finden – er scheiterte immer.
Erst als Geschichtenerzähler vermochte er zu reüssieren. Da war er bereits fünfzig und als Deckschrubber auf einem Dampfschiff wieder zurück nach London gekommen. Allerdings folgte er nicht dem Rat, seine Phantastereien als Roman herauszugeben. Er verkaufte sie lieber als seine eigenen Erlebnisse. Als wollte er Karl May in den Schatten stellen, erzählte er von seinem Leben bei den australischen Aborigines, die ihn zum Häuptling erkoren hätten, er habe Schildkröten geritten und fliegende Wombats gesehen. Er berichtete von Straßen aus Gold in Guinea, und dass er in kürzester Zeit beliebige Sprachen lernen könne. Seine Phantastereien konnte er sogar der Royal Geographical Society präsentieren.
Michael Hugentobler hat aus dieser außergewöhnlichen Lebensgeschichte einen herrlichen Roman gemacht, süffig zu lesen, voller Witz und Ironie. Und am Ende ist man sich nicht mehr sicher, ob man auf seinen Louis nicht doch auch hereinfallen würde.
Bei ihm ist es ein Hans Roth, der 1849 in einem Schweizer Bergdorf geboren wurde, schon aus jugendlicher auswanderte, durch die Welt reiste und sich eines Tages den Namen Louis de Montesanto gab. Er behauptete in Paris aufgewachsen zu sein und erzählt auch sonst jede Menge unglaubwürdiger Geschichten.
Es ist nur folgerichtig, dass Michael Hugentobler der wahre Lügengeschichte seines Landsmanns genauso fantastisch schweifen lässt wie sein Vorbild. Dessen Geschichte erfindet er nicht nur neu. Er spinnt sie weiter, indem er seine Tochter Old Lady Long in einem zweiten Erzählstrang auf die Suche nach dem Grab ihres Vaters schickt und sie in einem mit Efeu überwachsenen Haus auf ihren Bruder treffen lässt, das zweite Kind von Louis de Montesanto.
«Truth is stranger than fiction, but De Rougemont is stranger than both», hat das Wide World Magazine im Juni 1899 über den sensationellen Schwindler geschrieben. Die Wahrheit sei bizarrer als die Fiktion, aber De Rougemont noch seltsamer als beide – das möchte man seinem ehrlichen Nachfahren Michael Hugentobler nicht nachsagen. Aber als Erzähler ist er ebenso fulminant.
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 8. März 2018
Ted Gioia – «Jazz hören – Jazz verstehen»
thenoise, 10:16h
 Mit seinem neuen Buch «Jazz hören – Jazz verstehen» möchte der Jazzpianist, Musikwissenschaftler und Buchautor Ted Gioia Normal-Sterblichen dabei helfen, Jazz kennen und lieben zu lernen. Dafür brauche es nicht viel, meint er durchaus einleuchtend, bloß Neugier und offene Ohren – und dann heißt es hören, hören, hören. Das, so seine Empfehlung, macht man sinnvoller in Konzerten als am Plattenteller. Denn Jazz lebt von Kreativität und Spontaneität. Die Improvisation, so Gioia, ist der magischste Teil der Sprache des Jazz. Und diese Magie erlebt man nicht auf Reproduktionen. Wer im «Reich der perfekten Reproduktion» leben wolle, meint er, sei im Konzert einer Rock- oder Pop-Coverband gut aufgehoben. Jazz jedoch ist «für diejenigen, die dabei sein wollen, wenn ein Wunder passiert.»
Mit seinem neuen Buch «Jazz hören – Jazz verstehen» möchte der Jazzpianist, Musikwissenschaftler und Buchautor Ted Gioia Normal-Sterblichen dabei helfen, Jazz kennen und lieben zu lernen. Dafür brauche es nicht viel, meint er durchaus einleuchtend, bloß Neugier und offene Ohren – und dann heißt es hören, hören, hören. Das, so seine Empfehlung, macht man sinnvoller in Konzerten als am Plattenteller. Denn Jazz lebt von Kreativität und Spontaneität. Die Improvisation, so Gioia, ist der magischste Teil der Sprache des Jazz. Und diese Magie erlebt man nicht auf Reproduktionen. Wer im «Reich der perfekten Reproduktion» leben wolle, meint er, sei im Konzert einer Rock- oder Pop-Coverband gut aufgehoben. Jazz jedoch ist «für diejenigen, die dabei sein wollen, wenn ein Wunder passiert.»Könnte man aber das Wesen des Jazz tatsächlich verstehen, wenn man sich einfach in den Club setzt und hört, müsste Ted Gioia keine Betriebsanleitung schreiben. Auch er kann nicht auf sezierende Analyse und theoretische Grundlagen verzichten. Diese bettet er vergleichsweise leicht verdaulich ein, indem er unterschiedliche Facetten aufgreift und anhand wegweisender Kompositionen erklärt. Dass er sich dabei auch selbst widerspricht und auch sein beständiges Credo untergräbt, dass immer die Emotionalität im Vordergrund steht, trüben das Lesevergnügen und seine Glaubwürdigkeit. Doch viele Erläuterungen und Anregungen kann man als durchaus faire Entschädigung dafür betrachten.
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 22. Juli 2015
Andreas Dorau/Sven Regener – Ärger mit der Unsterblichkeit
thenoise, 21:58h
 Andreas Dorau zählt zu den skurrilen Figuren der deutschen Popmusik. Als Schüler wurde er durch einen Zufallstreffer zu einem der Aushängeschilder der Neuen Deutschen Welle. Sein Song «Fred vom Jupiter», der es in der österreichischen Hitparade auf Platz 13 und in Deutschland auf Platz 21 schaffte, darf auf keinem NDW-Sampler fehlen. Obwohl er weder als Musiker noch als Filmemacher durchschlagende Erfolge erzielte, ist er heute noch eine feste (Szene)Größe. Er veröffentlicht – wenn auch in großen Abständen – neue Werke, die durchweg in die Kategorie schwer vermarktbar fallen. Es fällt ihm offensichtlich nicht schwer, sich zwischen die Stühle zu setzen – eine durchaus achtenswerte Einstellung.
Andreas Dorau zählt zu den skurrilen Figuren der deutschen Popmusik. Als Schüler wurde er durch einen Zufallstreffer zu einem der Aushängeschilder der Neuen Deutschen Welle. Sein Song «Fred vom Jupiter», der es in der österreichischen Hitparade auf Platz 13 und in Deutschland auf Platz 21 schaffte, darf auf keinem NDW-Sampler fehlen. Obwohl er weder als Musiker noch als Filmemacher durchschlagende Erfolge erzielte, ist er heute noch eine feste (Szene)Größe. Er veröffentlicht – wenn auch in großen Abständen – neue Werke, die durchweg in die Kategorie schwer vermarktbar fallen. Es fällt ihm offensichtlich nicht schwer, sich zwischen die Stühle zu setzen – eine durchaus achtenswerte Einstellung. Doraus Erinnerungen, die von Sven Regener niedergeschrieben wurden, folgen durchweg einem Strickmuster: Auf die Erzählung einer Begebenheit aus Doraus Leben folgt eine Pointe, die mal mehr und meist weniger sitzt. Mehr als ein Schmunzeln entlocken die Texte jedoch kaum. Und die Seitenhiebe, mit denen er beispielsweise seinen ehemaligen Chef bedenkt, den aktuellen Berliner Kulturstaatssekretär, steigern den Lesegenuss ebenso wenig wie die Art, in der diese Geschichten erzählt werden. Denn selbst wenn man das Konzept der gesprochenen Sprache verfolgt, darf man eine Inspiration haben und muss nicht gleich von ihr überkommen werden. Wobei der Ton, den Sven Regener anschlägt, oft derart naiv ist, dass man sich gelegentlich fragt, ob nicht doch Ironie im Spiel ist.
Zu lesen lohnen sich die Geschichten also nicht wegen der literarischen oder sprachlichen Qualität, sondern weil Andreas Dorau ein origineller Protagonist der deutschen Musik seit den 80er-Jahren ist und weil er offenherzig ist und sich nicht scheut, seine Eigenheiten zu benennen, etwa dass er nur auf der Bühne und nur aus Angst tanze. Oder ist auch das schon wieder ein Märchen? Dorau steht zu seinen Fehlern und Fehleinschätzungen. So bekennt er etwa deutlich, sich nicht besser verhalten zu haben als die Epigonen, die die Neue Deutsche Welle in den Tod kommerzialisiert haben.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 6. April 2014
Alexander Schimmelbusch – Die Murau Identität
thenoise, 14:28h
 Die Idee ist erstklassig und kann Verehrer und Hasser von Thomas Bernhard gleichermaßen entzücken respektive aufregen: Thomas Bernhard lebt inkognito auf Mallorca, wie der in Berlin lebende österreichische Autor Alexander Schimmelbusch in seinem Roman ‹aufdeckt›. Er hat seinen Tod vorgetäuscht und sich in New York einer Antikörperbehandlung unterzogen. Auf Mallorca hat Thomas Bernhard dann erst mit seiner Frau Esmeralda gelebt, den mittlerweile als Banker in New York lebenden Sohn Esteban gezeugt. Nach Jahren der schriftstellerischen Abstinenz hat er doch wieder begonnen zu schreiben, was seine Frau vertrieben hat. Dann kommt ihm ein abgehalfterter Journalist auf die Spur und wittert eine exklusive Story.
Die Idee ist erstklassig und kann Verehrer und Hasser von Thomas Bernhard gleichermaßen entzücken respektive aufregen: Thomas Bernhard lebt inkognito auf Mallorca, wie der in Berlin lebende österreichische Autor Alexander Schimmelbusch in seinem Roman ‹aufdeckt›. Er hat seinen Tod vorgetäuscht und sich in New York einer Antikörperbehandlung unterzogen. Auf Mallorca hat Thomas Bernhard dann erst mit seiner Frau Esmeralda gelebt, den mittlerweile als Banker in New York lebenden Sohn Esteban gezeugt. Nach Jahren der schriftstellerischen Abstinenz hat er doch wieder begonnen zu schreiben, was seine Frau vertrieben hat. Dann kommt ihm ein abgehalfterter Journalist auf die Spur und wittert eine exklusive Story. «Die Murau Identität» spielt mit dem bekannten schwierigen Verhältnis von Verleger Siegfried Unseld und seinem Autor, versucht sich an Bernhards Furor und nimmt auch den Literaturbetrieb als ganzes aufs Korn. Damit hat Alexander Schimmelbusch zwar die besten Voraussetzungen für einen großartigen Text geschaffen, erreicht aber nicht mehr als einen bloß streckenweise kurzweiligen Roman. Der wehleidigen Sicht auf den Ich-Erzähler fehlt die Substanz, und weil Schimmelbusch nicht über die bernhardsche Sprachmacht verfügt, wird die Imitation von dessen wuchtiger Redundanz bloß zur hohlen Persiflage.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 23. Juni 2013
Hossein Mortezaeian Abkenar – Skorpion auf den Stufen des Bahnhofs von Andimeschk
thenoise, 19:29h
 Knapp, lakonisch und selbst Erschütterndes wird beiläufig erzählt: Die lange Erzählung von Hossein Mortezaeian Abkenar erinnert in mancherlei Hinsicht an die deutsche Trümmerliteratur. Kein Wunder, wenn der Vater der Texte der Krieg ist. Im Fall des iranischen Autors ist es der achtjährige Krieg, mit dem sich der Irak das von der Revolution geschwächte Nachbarland Iran einverleiben wollte. Hossein Mortezaeian Abkenar, der damals selbst als Soldat an die Front musste, beschreibt in «Skorpion» die schwierige Rückfahrt eines Kriegsheimkehrers. Halluzinierend und den Schikanen der Feldjäger ausgesetzt, die seine Entlassungsurkunde zerreißen, muss Mortesâ Hedâyati fürchten, als Deserteur wieder zurück an die Front geschickt zu werden. Zum Glück findet er immer wieder freundliche Helfer.
Knapp, lakonisch und selbst Erschütterndes wird beiläufig erzählt: Die lange Erzählung von Hossein Mortezaeian Abkenar erinnert in mancherlei Hinsicht an die deutsche Trümmerliteratur. Kein Wunder, wenn der Vater der Texte der Krieg ist. Im Fall des iranischen Autors ist es der achtjährige Krieg, mit dem sich der Irak das von der Revolution geschwächte Nachbarland Iran einverleiben wollte. Hossein Mortezaeian Abkenar, der damals selbst als Soldat an die Front musste, beschreibt in «Skorpion» die schwierige Rückfahrt eines Kriegsheimkehrers. Halluzinierend und den Schikanen der Feldjäger ausgesetzt, die seine Entlassungsurkunde zerreißen, muss Mortesâ Hedâyati fürchten, als Deserteur wieder zurück an die Front geschickt zu werden. Zum Glück findet er immer wieder freundliche Helfer. Vom Kriegsgeschehen völlig verstört wähnt Mortesâ Hedâyati noch immer seinen erschossenen Kameraden bei sich, gibt diesem Befehle und kümmert sich um ihn. Vielem anderem gegenüber ist er wiederum völlig gleichgültig. Selbst als ein anderer Mitfahrer, der neben ihm auf der Fahrt stirbt, vom Lastwagenchauffeur mit einem kurzen Gebet durch die Fahrertür auf die Straße geschubst wird, empfindet er offenbar keine Regung. Der Krieg – so vermittelt der Autor eindringlich und ohne es direkt zu benennen – hat alle abgestumpft, Mortesâ Hedâyati funktioniert wie eine Maschine.
«Skorpion auf den Stufen des Bahnhofs von Andimeschk» ist 2006 erschienen und wurde in der damaligen liberalen Phase sogar mit Preisen ausgezeichnet. Mittlerweile darf die Erzählung nicht mehr neu aufgelegt werden. Der anklagende Impetus, der in ihr steckt, passt nicht zur patriotischen Revolutions-Rhetorik, mit der sich das Regime verstärkt zu legitimieren versucht. Hossein Mortezaeian Abkenar schildert kein heldenhaftes Kriegsgeschehen, sondern stellt den Druck in den Vordergrund, den das eigene Regime ausübt. Er drückt sogar das Mitleid mit den gegnerischen Soldaten aus und überwindet so den nationalen Blickwinkel. Der Iran-Irak-Krieg dient ihm nur als Beispiel, an dem er die Auswirkungen des Krieges zeigt und verdeutlicht, dass dieser zu innerer Repression führt. Verstärkt wird der verstörende Eindruck durch abrupte Wechsel von Erzählung und Selbstgespräch, von Beschreibung und Delirium. Dann bringt der Autor nicht nur abgehackte Sätze, sondern zeigt das auch am Satzbild, indem er kurzerhand auf die Interpunktion verzichtet .
Mit knapper Sprache hat Hossein Mortezaeian Abkenar einen eindringlichen Text über die Folgen des Krieges geschaffen, der nicht nur deswegen aktuell ist, weil in zahlreichen Ländern Krieg geführt wird. Er sollte bei uns Verständnis wecken, weil 25 Jahre nach dem Ende des Iran-Irak-Kriegs wiederum Länder des nahen Ostens Schauplatz kriegerischer Auseinandersetzungen sind oder unter deren Folgen leiden. Die Erzählung vermittelt deutlich die seelische Verfassung, in der sich viele Kriegsopfer befinden, die bei uns Schutz suchen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 6. Juni 2013
Tschingis Aitmatow, Juri Rytchëu, Galsan Tschinag – Die Kraft der Schamanen
thenoise, 18:06h
 Wenn der Arzt nicht helfen kann, geht man auch in unseren Breitengraden zum Schamanen. Früher hieß er hier Kräuterdoktor, ganz früher Hexe und heutzutage Heilpraktiker. Der spirituelle Anteil seiner Arbeit spielt – anders als in Asien, wo man auch vor einer Reise seinen Haus-Lama oder einen Lama im Kloster aufsucht – hier kaum noch eine Rolle. In dem schmalen Bändchen sind Texte von Tschingis Aitmatow, Juri Rytchëu und Galsan Tschinag versammelt, die einem vergleichbaren Kulturkreis entstammen, in dem der Schamanismus noch lebendig ist.
Wenn der Arzt nicht helfen kann, geht man auch in unseren Breitengraden zum Schamanen. Früher hieß er hier Kräuterdoktor, ganz früher Hexe und heutzutage Heilpraktiker. Der spirituelle Anteil seiner Arbeit spielt – anders als in Asien, wo man auch vor einer Reise seinen Haus-Lama oder einen Lama im Kloster aufsucht – hier kaum noch eine Rolle. In dem schmalen Bändchen sind Texte von Tschingis Aitmatow, Juri Rytchëu und Galsan Tschinag versammelt, die einem vergleichbaren Kulturkreis entstammen, in dem der Schamanismus noch lebendig ist. In totalitären Systemen wird Wissen und Wirken von Schamanen als Risikofaktor eingestuft. So wurde ihnen beispielsweise in der Sowjetunion die Berufsausübung verboten. «Die alte Schamanenkultur ist wegen des äußeren Drucks und des Verbots der Rituale in den Untergrund gegangen», erinnert sich etwa Juri Rytchëu, dessen Großvater ein Schamane war und deshalb vom Vorsitzenden eines Revolutionskomittees ermordet wurde. Der Untergrund, so der Autor, «war noch nicht einmal tief»; der Schamanismus konnte leicht im Verborgenen weiterblühen.
Die hier vorgestellten Texte – sie sind bereits erschienenen Werken der drei Autoren entnommen – zeigen unterschiedliche Facetten. Tschingis Aitmatow beschreibt, wie er die Wirkung der schamanischen Kraft als Kind erlebte, Juri Rytchëu erzählt überaus amüsant von der langwierigen und zermürbenden Inauguration des Großvaters zum Schamanen und wie dieser als lebendes Exponat zur Sensation der Weltausstellung in Chicago wurde. Galsan Tschinag, der in Deutschland studierte und Stammesoberhaupt im turksprachigen Tuwa ist, beschreibt seinen eigenen Weg zum Schamanen. Dazu erzählt er von den Erfolgen seiner schamanischen Tante Pürwü, deren Heilkraft auch über hunderte Kilometer hinweg spürbar gewesen sei. Nicht zuletzt berichtet er auch allgemein über Tradition und Bedeutung des Schamanentums.
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 26. Februar 2013
Markus Bundi - Emilies Schweigen
thenoise, 18:27h
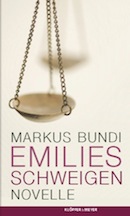 Der Autor als Gerichtsreporter: «Emilies Schweigen» spielt überwiegend im Gerichtssaal. Dort findet ein Indizienprozess statt, der das ganze Land bewegt. 47 Menschen soll die Altenpflegerin Emilie T. umgebracht haben, Dunkelziffer ungewiss. Beweise gibt es keine – kein Gift, keine Spuren, keine Zeugen. Und Emilie schweigt. Auch mit ihrem Pflichtverteidiger spricht sie nicht.
Der Autor als Gerichtsreporter: «Emilies Schweigen» spielt überwiegend im Gerichtssaal. Dort findet ein Indizienprozess statt, der das ganze Land bewegt. 47 Menschen soll die Altenpflegerin Emilie T. umgebracht haben, Dunkelziffer ungewiss. Beweise gibt es keine – kein Gift, keine Spuren, keine Zeugen. Und Emilie schweigt. Auch mit ihrem Pflichtverteidiger spricht sie nicht. Für den 32-jährigen David Moor, der als Pflichtverteidiger brilliert, wird der Fall zum Karriere-Booster. Er weckt den Sportsgeist des Schachspielers, dem das Schweigen der Angeklagten erlaubt, der Strategie der Anklage ganz nach seinem eigenen Gutdünken Paroli zu bieten. Obwohl die Meinung schon gemacht ist – die Medien verurteilten Emilie T. vorab als Todesengel – gelingt es David Moor, Zug um Zug die Schlussfolgerungen des Staatsanwaltes und des untersuchenden Hauptkommissars zu zerpflücken und die Medien auf seine Linie zu bringen.
Vordergründig schildert Markus Bundi einen besonderen Gerichtsfall. Das macht er spannend, aber das reicht ihm nicht. Denn er erzählt diese Geschichte nicht als allwissender Erzähler und auch nicht aus dem Blickwinkel des unmittelbar am Prozess beteiligten Anwalts David Moor. Erzähler ist vielmehr dessen Freund aus Studienzeiten, der gleich im Prolog zugibt, viele der Informationen nicht aus erster Hand zu haben, sondern aus den Medien. Er sei nicht ein einziges Mal im Gerichtssaal gewesen und würde beispielsweise ausser Acht lassen, dass am Prozess gleich mehrere Richter beteiligt seien. Er wolle den Mechanismus aufzeigen, legt Markus Bundi seinem Erzähler in den Mund, der zum für viele überraschenden Ausgang des Prozesses geführt hätten. Die Medien schlachten jede Wendung im Prozess aus und bestimmen mit ihrer ausufernden Berichterstattung die Sicht auf die Angeklagte und ihre Tat zumindest für die Öffentlichkeit mehr als die Personen, die mit der Aufklärung der Tat beschäftigt sind.
So stellt Markus Bundi in seiner leichtfüssig erzählten Geschichte ganz zwanglos die Frage nach der Rolle der Medien in unserer Gesellschaft und regt zum Nachdenken darüber an, wie sie unsere Wahrnehmung beeinflussen. Auch sie, so die naheliegende Schlussfolgerung, wählen aus den vorhandenen Informationen aus und erzählen uns so eine Geschichte. Und das machen sie, schliesslich möchten sie Aufmerksamkeit erwecken, möglichst spannend. Manche der medial präsentierten Geschichten mögen so rätselhaft sein wie die der bis zum Freispruch schweigenden Emilie T. – so gut erzählt wie «Emilies Schweigen» sind sie meistens nicht.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 13. Januar 2013
Martina Mettner - Fotografie mit Leidenschaft
thenoise, 17:49h
 Lerne von deinen Vorgängern, aber kopiere sie nicht. Verfolge deinen Weg leidenschaftlich und entwickle deine eigene Bildsprache, ohne auf die Verkäuflichkeit des Ergebnisses zu achten. Wenn du dann noch die richtigen Leute kennst, steht einer erfolgreichen Karriere nichts mehr im Weg.
Lerne von deinen Vorgängern, aber kopiere sie nicht. Verfolge deinen Weg leidenschaftlich und entwickle deine eigene Bildsprache, ohne auf die Verkäuflichkeit des Ergebnisses zu achten. Wenn du dann noch die richtigen Leute kennst, steht einer erfolgreichen Karriere nichts mehr im Weg. Die Rezepte, die Martina Mettner angehenden Fotografen auf den Weg gibt, sind mitunter simpel. Aber oft braucht es eben einen Berater, um auf die richtige Spur zu kommen.
Mit ihrem Buch «Fotografie mit Leidenschaft» vermittelt Martina Mettner was es braucht, um als Fotograf erfolgreich zu sein und hilft so jungen Menschen dabei, eine Entscheidung über ihren zukünftigen Lebensweg zu treffen. Ambitionierte Amateure wiederum ermutigt sie, sich vom Knipser, der lediglich das Gesehene abbildet, zum Künstler mit einer eigenen Bildsprache, mit einem eigenen Stil zu entwickeln.
Dazu erläutert sie unterschiedliche Genres und Herangehensweisen anerkannter Fotografen – vom Schnappschuss des Veteranen der Strassenfotografie, Henri Cartier-Bresson, und Chronisten wie Walker Evans und Robert Frank über Porträt- und Landschaftsfotografie am Beispiel von August Sander und Richard Avedon beziehungsweise Guy Tillim und Heinrich Riebesehl.
Indem die Autorin die unterschiedlichen Herangehensweisen und Temperamente der Fotografen beschreibt, zeigt sie auch, dass es nicht zwangsläufig ein «richtig» oder «falsch» gibt. Robert Frank beispielsweise dachte schon von Anfang an in Bildstrecken, und die Vertreter der Straßenfotografie konnten mit den Bildern der «f.64»-Gruppe um Ansel Adams, Edward Weston und Imogen Cunningham nichts anfangen.
Immer wieder analysiert Martina Mettner ausgewählte Bilder und erklärt so Haltung und Herangehensweise von Fotopionieren und was eine Fotografie zum Meisterwerk macht. Ganz wesentlich geht es ihr um die zeitgenössische Fotografie. So erklärt sie anhand eines Bildes von Guy Tillim, was zeitgenössische Landschaftsfotografie ausmacht oder die originelle Herangehensweise von Corey Arnold, die sich aus seiner Arbeit als Berufsfischer ergibt oder der Schauspielerin Margarita Broich, die sich und ihre Kollegen in einem besonderen Moment fotografiert: unmittelbar dann, wenn sie von der Bühne abtreten und – noch gezeichnet von der Arbeit als Schauspieler – in die Garderobe kommen.
Ein wichtiger Teil des Buches sind praktische Tipps zur Realisierung freier Projekte. Hier verdichtet die Autorin noch einmal, was sie dem Leser en passant auf den Weg gegeben hat, gibt weitere Anregungen und warnt vor Fallen und Fehleinschätzungen, in die auch gestandene Fotografen offenbar immer wieder tappen.
«Fotografie mit Leidenschaft» ist nicht nur für Fotografen, die sich auf den Sprung zum Profi sehen, ein hilfreiches Buch. Amateure, denen es nicht mehr reicht, nur «schöne» Landschaftsbilder oder Porträts zu machen, die der Schwiegermutter zu gefallen, finden wertvolle Anregungen. Auch das sagt Martina Mettner deutlich: Nicht jeder, der Talent hat, soll Berufsfotograf werden. Und wer auf den Markt schielt, hat oft schon verloren. Ohnehin, sagt sie anhand historischer Beispiele, macht der Fotograf die beste Arbeit «generell für sich selbst.» Oft ist das der Weg ins Museum – wenn es auch meist nicht gleich das Moma ist.
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 9. Januar 2013
Daniel Odija - Auf offener Straße
thenoise, 20:11h
 Schon der Name der Straße, in der Daniel Odijas Romans angesiedelt ist, zeigt, dass nicht alle Versprechungen eingehalten werden. Die ulica Długa, die Lange Straße, ist in Wirklichkeit sehr kurz. Aber sie hält viele Geschichten über die wenigen Bewohner bereit, die der junge polnische Autor in dichten Miniaturen erzählt.
Schon der Name der Straße, in der Daniel Odijas Romans angesiedelt ist, zeigt, dass nicht alle Versprechungen eingehalten werden. Die ulica Długa, die Lange Straße, ist in Wirklichkeit sehr kurz. Aber sie hält viele Geschichten über die wenigen Bewohner bereit, die der junge polnische Autor in dichten Miniaturen erzählt. Die wenigen Bewohner sind einander oft in Abneigung zugetan, oder sie ignorieren sich einfach. Keiner hat eine Perspektive. Die jungen Burschen bestreiten ihren Lebensunterhalt durch Diebstähle. Die drei Cebula-Schwestern, die jüngste von ihnen noch minderjährig, prostituieren sich für Praktisches wie Videorekorder und Bügeleisen, welche die Freier von ihren Beutezügen in der nächsten großen Stadt mitbringen. Menschen wie der kuriose Bettler Hobbit, der monatlich so viel Geld einnimmt wie ein Arbeiter an verdient, oder Gustav Chmara, der den Hinterhof begrünt, sind die Ausnahme – und vor allem nicht ohne Schattenseiten. Sobald Chamara seinen Hinterhof herausgeputzt hat, wird er zum Ordnungsfanatiker, der seine Umgebung tyrannisiert. Ohnehin sind Menschen wie Pattex die Regel. Der schnüffelt sich einfach aus dem Elend heraus.
Selbst in ihren Träumen finden sich die Bewohner der ulica Długa im Elend wieder. Hier hat kaum einer eine Perspektive. Ausbruchsversuche, die über den Seitensprung mit der Nachbarin hinausgehen, scheitern. Auch Kanada, den man so nennt, weil er mit einem Stipendium nach Amerika ausgewandert war, kehrte zurück «vielleicht weil er musste und seine Pläne nicht aufgegangen waren, falls er überhaupt welche gehabt hatte, auf jeden Fall begann er zu trinken.»
Daniel Odijas Text ist kein konventioneller Roman, sondern vielmehr eine Ansammlung von kurzen Geschichten, manchmal gar nur von knappen Momentaufnahmen. Odija schreibt äußerst verdichtete Kurzprosa, die reich an Bildern und treffenden Beschreibungen ist. Odijas Blick auf die Protagonisten ist nüchtern und distanziert. Er bemitleidet sie nicht, wertet sie aber auch nicht ab.
Mit bitterem Realismus, deren fotografische Pendants bei den Arbeiten von Robert Frank («The Americans») und Walker Evans («Let Us Now Praise Famous Men») liegen, zeigt Daniel Odija, dass sich für die zeitlos Ausgegrenzten auch durch den Wechsel der Herrschenden die Lebensbedingungen nicht verbessert haben.
... link (0 Kommentare) ... comment
... nächste Seite