Samstag, 5. April 2014
Die Heiterkeit - Monterey
thenoise, 14:03h
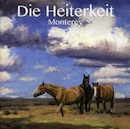 Am Hinweis, dass die Sängerin des Hamburger Trios Die Heiterkeit auf bemerkenswert Weise nicht singen kann, führt kein Weg vorbei. Dabei ist das keineswegs außergewöhnlich. Stella Sommer ist nicht die erste in der Welt der Popmusik, der es an der stimmlichen Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere fehlt. Musiker wie Lou Reed und Blixa Bargeld oder die im Zusammenhang mit Die Heiterkeit immer wieder strapazierten Nico und Hildegard Knef haben dieses Manko ausgeglichen, indem sie sich die Musik auf ihr mangelndes Ausdrucksvermögen hin zuschnitten. Nico wirkte gerade deswegen cool und Hildegard Knef authentisch.
Am Hinweis, dass die Sängerin des Hamburger Trios Die Heiterkeit auf bemerkenswert Weise nicht singen kann, führt kein Weg vorbei. Dabei ist das keineswegs außergewöhnlich. Stella Sommer ist nicht die erste in der Welt der Popmusik, der es an der stimmlichen Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere fehlt. Musiker wie Lou Reed und Blixa Bargeld oder die im Zusammenhang mit Die Heiterkeit immer wieder strapazierten Nico und Hildegard Knef haben dieses Manko ausgeglichen, indem sie sich die Musik auf ihr mangelndes Ausdrucksvermögen hin zuschnitten. Nico wirkte gerade deswegen cool und Hildegard Knef authentisch.Ihr Asset der ungewöhnlichen Stimme kombiniert das Trio mit den seit den 80er-Jahren bekannten Stärken: Der simplen Umsetzung im Stil der «Genialen Dilettanten» und der richtigen Attitüde. Passend dazu hat Heiterkeit-Bassistin Rabea Erradi den melodiös-warmen, unverwechselbaren Bassklang von Joy Division ausgegraben, und auch der Keyboard-Einsatz weist in diese Ära.
Die Heiterkeit auf Reminiszenzen und Attitüde zu reduzieren, wäre ungerecht. Denn die drei spielen mit der stringent unterkühlte Haltung, die sie an den Tag legen. Wenn Stella Sommer an eine Textzeile ein tiefes «hoho» dranhängt, damit der Reim gewahrt bleibt, darf man das durchaus als Verballhornung der Schlagerkonvention. Anders als etwa bei den Lassie Singers oder bei Almut Klotz nähern sich die simplen, getragenen Melodien des Trios dem Schlager kaum an. Und auch die Texte von Stella Sommer sind weit davon entfernt. Obwohl sie oft von der Liebe handeln ist sie weit weg von falschen Gefühlen und eindeutigen Aussagen. Stella Sommer – die immer mit eigenwilligen Einfällen und Wendungen überrascht – lässt in ihren Texten viel im Ungefähren, was diese eigenständiger macht als die gefällig-melancholischen Arrangements, zu denen sie vorgetragen werden.
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 11. Februar 2014
“Stimmen Bayerns – Die Freiheit”
thenoise, 19:03h
 Die Bayern sagen sich ein besonderes Verhältnis zur Freiheit nach. Außerhalb des Bundeslandes registriert man das vor allem durch die idyllisierende Stilisierung des Räubers und Polizistenmörders Matthias Kneißl zum Freiheitsheld und vielleicht mehr noch, weil sie auf der bundespolitischen Bühne ständig eine Sonderrolle für sich beanspruchen. Dass es zahlreiche Zeugnisse des bayerischen Freiheitsdrangs gibt, zeigt die jüngste Ausgabe der Reihe «Stimmen Bayerns», die – natürlich aus bayerischer Perspektive – so ziemlich alle Facetten der Freiheit beleuchtet. Das reicht von Georg Queris Erzählung vom «Haberfeldtreiben», ein Brauch aus dem 18. Jahrhundert, bis hin zu den Schwabinger Krawallen im Jahr 1962. Die Zahl der Beiträger ist so illuster wie die Bandbreite. Die üblichen Verdächtigen – Georg Ringsgwandl, Gerhard Polt, Willy Michl und die Spider Murphy Gang – fehlen ebenso wenig wie so obskure Beiträger wie Sigurd Kämpft. Das ergibt eine Mischung, die amüsant und abwechslungsreich ist, die nachdenklich stimmt und zwischendurch auch nervt. Selbst wenn es stimmen sollte, dass die Bayern freiheitsliebender sind als die Menschen in anderen Bundesländern: Der künstlerische Ausdruck erreicht nicht bei allen Beiträgern die Intensität der Freiheitsliebe. Dichter wäre die Zusammenstellung geworden, wenn man sich auf eine CD beschränkt hätte.
Die Bayern sagen sich ein besonderes Verhältnis zur Freiheit nach. Außerhalb des Bundeslandes registriert man das vor allem durch die idyllisierende Stilisierung des Räubers und Polizistenmörders Matthias Kneißl zum Freiheitsheld und vielleicht mehr noch, weil sie auf der bundespolitischen Bühne ständig eine Sonderrolle für sich beanspruchen. Dass es zahlreiche Zeugnisse des bayerischen Freiheitsdrangs gibt, zeigt die jüngste Ausgabe der Reihe «Stimmen Bayerns», die – natürlich aus bayerischer Perspektive – so ziemlich alle Facetten der Freiheit beleuchtet. Das reicht von Georg Queris Erzählung vom «Haberfeldtreiben», ein Brauch aus dem 18. Jahrhundert, bis hin zu den Schwabinger Krawallen im Jahr 1962. Die Zahl der Beiträger ist so illuster wie die Bandbreite. Die üblichen Verdächtigen – Georg Ringsgwandl, Gerhard Polt, Willy Michl und die Spider Murphy Gang – fehlen ebenso wenig wie so obskure Beiträger wie Sigurd Kämpft. Das ergibt eine Mischung, die amüsant und abwechslungsreich ist, die nachdenklich stimmt und zwischendurch auch nervt. Selbst wenn es stimmen sollte, dass die Bayern freiheitsliebender sind als die Menschen in anderen Bundesländern: Der künstlerische Ausdruck erreicht nicht bei allen Beiträgern die Intensität der Freiheitsliebe. Dichter wäre die Zusammenstellung geworden, wenn man sich auf eine CD beschränkt hätte.... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 8. Februar 2014
Guz - Der beste Freund des Menschen
thenoise, 14:09h
 Diplomatische Bemühungen reichen nicht, um Nordkorea zu befreien. Das schafft nur General Guz, der zwar mit Pauken, aber ganz ohne Fanfaren in der nordkoreanischen Hauptstadt einreitet. Seine Eroberungshymne, «General Guz befreit Pyongyang», ist ein Instrumentalstück mit Rock’n'Roll-Schlagzeug und Italo-Western-Trompete. Sie wirkt ein wenig wie die Erkennungsmelodie einer Kinder-TV-Serie – mit einem Diktator, der so lächerlich ist wie die Daltons, und einem General der sich selbstironisch als Mischung aus Rin Tin Tin und Rantanplan sieht.
Diplomatische Bemühungen reichen nicht, um Nordkorea zu befreien. Das schafft nur General Guz, der zwar mit Pauken, aber ganz ohne Fanfaren in der nordkoreanischen Hauptstadt einreitet. Seine Eroberungshymne, «General Guz befreit Pyongyang», ist ein Instrumentalstück mit Rock’n'Roll-Schlagzeug und Italo-Western-Trompete. Sie wirkt ein wenig wie die Erkennungsmelodie einer Kinder-TV-Serie – mit einem Diktator, der so lächerlich ist wie die Daltons, und einem General der sich selbstironisch als Mischung aus Rin Tin Tin und Rantanplan sieht.Guz mischt die Stile, strickt «Hey Jude» von den Beatles um und fegt im Charleston-Schritt aufs Parkett. Dazu erzählt er seine allltagsbanalen Geschichten («Hassloch») und ernsten Nonsens («Komm lass uns Drogen nehmen und rumfahr’n»). In seinen scheinbar simplen Liedern steckt wie immer wesentlich mehr als man auf Anhieb erkennt. So konterkariert er die kleinbürgerliche Zufriedenheit, die die hessische Kleinstadt Hassloch ausstrahlt , indem er das Finale des Stücks ironisch-bombastisch aufbauscht. Und wenn er zurückschaut («1984»), macht er das mit einem selbstironisch-spöttischen Blick. «Ich und meine Scheiß-Band – ich hoffe, ihr habt uns nie gehört. Ich wollte nur eine Freundin, doch sie hielt mich für total gestört», lässt er sein lyrisches Ich über seine ursprüngliche Motivation berichten, die ihn zur Musik geführt hat. (In einem vor vielen Jahren geführten Interview gab er einen anderen, realistischer wirkenden Grund an.)
Wie immer erzählt der Schaffhauser Liedermacher seine Geschichten aus dem Alltag mit liebevoll-sarkastischem Blick. Wiederum hat er die meisten Instrumente selbst eingespielt und sein Stil-Repertoire erweitert. Doch egal, welchen Stil er auch zitiert, es bleibt immer Guz.
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 10. Januar 2014
Heimatlieder aus Deutschland
thenoise, 21:37h
 Für Lissabon-Reisende zählt der Besuch eines Fado-Lokals ebenso zum Pflichtprogramm wie der Abend mit chinesischer Musik beim Peking-Aufenthalt oder Wasserpuppenspiele in Vietnam. Dass uns die gleiche exotische Vielfalt 'um die Ecke' geboten wird, macht das Projekt «Heimatlieder aus Deutschland» bewusst. Es versammelt 26 Stücke, eingespielt von 13 Gruppen, in denen in Berlin lebenden Einwanderern ihr heimisches Liedgut pflegen. Da gibt es für Weltmusikhörer so Selbstverständliches wie Fado oder kubanischen Son, aber auch hier selten zu hörende marokkanische Gnawa-Musik, lebensfrohe Marrabenta-Musik aus Mosambik oder erstaunliche Klänge aus Korea. Letztere wirken nämlich weit weniger exotisch als vermutet.
Für Lissabon-Reisende zählt der Besuch eines Fado-Lokals ebenso zum Pflichtprogramm wie der Abend mit chinesischer Musik beim Peking-Aufenthalt oder Wasserpuppenspiele in Vietnam. Dass uns die gleiche exotische Vielfalt 'um die Ecke' geboten wird, macht das Projekt «Heimatlieder aus Deutschland» bewusst. Es versammelt 26 Stücke, eingespielt von 13 Gruppen, in denen in Berlin lebenden Einwanderern ihr heimisches Liedgut pflegen. Da gibt es für Weltmusikhörer so Selbstverständliches wie Fado oder kubanischen Son, aber auch hier selten zu hörende marokkanische Gnawa-Musik, lebensfrohe Marrabenta-Musik aus Mosambik oder erstaunliche Klänge aus Korea. Letztere wirken nämlich weit weniger exotisch als vermutet.Von der Polyphonie aus Dalmatien bis zum Quan ho-Gesang aus Vietnam – alleine ein Blick auf die Vokalensembles, die auf diesem Album in der Mehrzahl sind, zeigt die Bandbreite der Musik. Abgesehen von der Vielfalt, die diese Zusammenstellung bietet, zeigt «Heimatlieder aus Deutschland» eindrücklich, wie viel Talent und Kreativität die Emigranten aus aller Welt in unser Land bringen. Dass dieser Schatz wahrgenommen und gehoben wird, ist überfällig.
... link (0 Kommentare) ... comment
Dienstag, 17. September 2013
Thomas Gansch/Georg Breinschmid – Gansch & Breinschmid Live
thenoise, 21:16h
 Ihre Moderationen seien so schlecht, kommentieren die beiden Musiker, dass ihnen vom Österreichischen Fernsehen bald eine Talkshow angeboten werde. Auch wenn sie das lustig meinen und auch einige durchaus gelungene Gags anbringen – weit daneben liegen sie nicht. Einmal mehr mit österreichischen Stereotypen wie dem Tod und der Verbeamtung zu kokettieren, ist nur mäßig originell. Doch Humor ist zu einem guten Teil Geschmackssache, und die Gstanzl – mit denen sie über die phlegmatisch-pragmatisierten Orchestermusiker herziehen – bringen sie durchaus verschmitzt und mit Verve.
Ihre Moderationen seien so schlecht, kommentieren die beiden Musiker, dass ihnen vom Österreichischen Fernsehen bald eine Talkshow angeboten werde. Auch wenn sie das lustig meinen und auch einige durchaus gelungene Gags anbringen – weit daneben liegen sie nicht. Einmal mehr mit österreichischen Stereotypen wie dem Tod und der Verbeamtung zu kokettieren, ist nur mäßig originell. Doch Humor ist zu einem guten Teil Geschmackssache, und die Gstanzl – mit denen sie über die phlegmatisch-pragmatisierten Orchestermusiker herziehen – bringen sie durchaus verschmitzt und mit Verve.Doch auch wer den Humor der beiden Musiker nur streckenweise teilt, kann sich für die eloquente Mischung aus Klassik, Jazz und Pop begeistern. Da trifft Johann Strauss erst auf Charlie Parker und später auf die Beatles, mit eigenen Stücken zeigen sie sich nicht nur als Kenner der jüngeren Pop-Geschichte («Kurt» zitiert Nirvanas «Come As You Are»), sondern auch als launige Liedermacher und mit «Der Tod» geben die beiden Virtuosen ihrem Programm gar eine kabarettistische Note.
Zwei Instrumente, viele Töne – und letztlich doch auch ziemlich viel Witz: Mit ihrem unmittelbar vor dem prognostizierten Weltende im Dezember 2012 aufgenommenen “The End” zeigen sich Thomas Gansch und Georg Breinschmid von ihrer besten Seite.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 7. Juli 2013
Red Baraat –Shruggy Ji
thenoise, 22:51h
 Früher sorgte der Kolonialismus für den Kulturaustausch – zum Beispiel indem die Briten die Blasmusik nach Indien brachten. Das veränderte die nordindische Musikkultur, in der es längst üblich sein soll, die Braut am Hochzeitstag auf ihrem Weg zum Haus der Bräutigams mit fröhlich-treibender Blasmusik zu begleiten. Mit ihrer von der Baraat-Zeremonie inspirierten Spielart bringen Red Baarat die Blasmusik auf friedlichem Weg wieder zurück. Und obwohl es weder in ihrer Heimat, noch in Europa einen Mangel an quirligen Blasmusikgruppen gibt, wurde die Musik von Red Baraat begeistert aufgenommen.
Früher sorgte der Kolonialismus für den Kulturaustausch – zum Beispiel indem die Briten die Blasmusik nach Indien brachten. Das veränderte die nordindische Musikkultur, in der es längst üblich sein soll, die Braut am Hochzeitstag auf ihrem Weg zum Haus der Bräutigams mit fröhlich-treibender Blasmusik zu begleiten. Mit ihrer von der Baraat-Zeremonie inspirierten Spielart bringen Red Baarat die Blasmusik auf friedlichem Weg wieder zurück. Und obwohl es weder in ihrer Heimat, noch in Europa einen Mangel an quirligen Blasmusikgruppen gibt, wurde die Musik von Red Baraat begeistert aufgenommen.Wie auf dem erste Album («Chaal Baby», 2012) bringt die achtköpfige Band auch auf «Shruggy Ji» fröhlich-schrille Tanzmusik, die sich mit ausgelassenen Marching-Bands ebenso locker messen kann wie mit furiosen Balkan-Bläsern. Die in New York beheimatete Gruppe um Dhol-Spieler Sunny Jain verschmilzt den vitalen Bhangra-Rhythmus mit Funk, Latin und Jazz, garniert mit ausgelassenen Gesängen und fetzigen Soli.
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 13. Juni 2013
Blockflöte des Todes - Ich habe heute Ananas gegessen
thenoise, 00:14h
 Dreijährige sagen gerne «Scheiße» und andere tagtäglich von Erwachsenen verwendete Begriffe, die zumindest nach Ansicht der Erziehungsberechtigten zumindest für ihren Nachwuchs ziemlich bäh sind. Auch Matthias Schrei gibt sich, wenngleich auf dem Niveau eines Vierzehnjährigen, gerne infantil. Das ist nur manchmal lustig, und auch dann nur wenig. Brachte er auf seinem ersten Album «Wenn Blicke flöten könnten», vergnügliche Nonsens-Texte und Ideen, die einen Song lang trugen, so wirken die Einfälle von Matthias Schrei auf dem neuen Album vor allem eines: bemüht. Das Ableben von Musikern zu thematisieren («Jim Morrison hat uns gelehrt», sing er, «wenn man sterben will ist eine Überdosis nicht verkehrt»), ist durchaus angebracht. Den Tod von einem witzigen Standpunkt aus zu betrachten, ist ebensowenig verkehrt. Doch Reime wie «Was könnte es Schöneres geben, als am Ende seines Lebens / nochmals Drogen zu nehmen und ein Groupie zu ficken und zur Krönung an der eigenen Kotze zu ersticken», laufen als Provokationsversuch ins Leere. Das kann man heute gefahrlos im Radio spielen.
Dreijährige sagen gerne «Scheiße» und andere tagtäglich von Erwachsenen verwendete Begriffe, die zumindest nach Ansicht der Erziehungsberechtigten zumindest für ihren Nachwuchs ziemlich bäh sind. Auch Matthias Schrei gibt sich, wenngleich auf dem Niveau eines Vierzehnjährigen, gerne infantil. Das ist nur manchmal lustig, und auch dann nur wenig. Brachte er auf seinem ersten Album «Wenn Blicke flöten könnten», vergnügliche Nonsens-Texte und Ideen, die einen Song lang trugen, so wirken die Einfälle von Matthias Schrei auf dem neuen Album vor allem eines: bemüht. Das Ableben von Musikern zu thematisieren («Jim Morrison hat uns gelehrt», sing er, «wenn man sterben will ist eine Überdosis nicht verkehrt»), ist durchaus angebracht. Den Tod von einem witzigen Standpunkt aus zu betrachten, ist ebensowenig verkehrt. Doch Reime wie «Was könnte es Schöneres geben, als am Ende seines Lebens / nochmals Drogen zu nehmen und ein Groupie zu ficken und zur Krönung an der eigenen Kotze zu ersticken», laufen als Provokationsversuch ins Leere. Das kann man heute gefahrlos im Radio spielen.Bei solchen Texten macht Matthias Schrei auch nicht wett, dass er fluffig-flotte Popsongs ebenso eloquent bringt wie Rockiges und Easy Listening und bei der Mehrzahl der Songs alle Instrumente selbst eingespielt hat. Das ist vielversprechend – hören wir weiter, wenn er die spätpubertäre Phase abgeschlossen hat.
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 1. Juni 2013
Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba – Jama ko
thenoise, 15:42h
 Vor einigen Jahren hat Bassekou Kouyaté ein eigentlich simples, aber trotzdem überaus originelles Konzept umgesetzt: ein Ngoni-Ensemble, vergleichbar einem Streichquartett, mit dem er eigene und traditionelle Liedern unterschiedlicher Ethnien interpretiert und damit auf Anhieb internationale Erfolge feierte. Seine Klänge und Kompositionen selbst sind nicht experimentell. Und in einer Zeit, in der selbst auf malischen Dorffesten die Musikanten mit elektrifizierten traditionellen Instrumenten spielen, ist auch Kouyatés Einsatz von Effektgeräten nicht mehr außergewöhnlich.
Vor einigen Jahren hat Bassekou Kouyaté ein eigentlich simples, aber trotzdem überaus originelles Konzept umgesetzt: ein Ngoni-Ensemble, vergleichbar einem Streichquartett, mit dem er eigene und traditionelle Liedern unterschiedlicher Ethnien interpretiert und damit auf Anhieb internationale Erfolge feierte. Seine Klänge und Kompositionen selbst sind nicht experimentell. Und in einer Zeit, in der selbst auf malischen Dorffesten die Musikanten mit elektrifizierten traditionellen Instrumenten spielen, ist auch Kouyatés Einsatz von Effektgeräten nicht mehr außergewöhnlich.So ist es kaum verwunderlich, dass die interessanteste Weiterentwicklung von Bassekou Kouyaté nicht im musikalischen Bereich liegt. Hier steht er zwar nicht still, variiert aber doch ‘nur’ das bestehende Konzept. Auch die wiederholte Zusammenarbeit mit Taj Mahal, so nett das Ergebnis auch sein mag, führt nur einmal mehr zusammen, was schon öfters zusammengeführt wurde – den Blues und die afrikanische Musik, die von vielen als dessen Ursprung betrachtet wird.
Bemerkenswerter ist daher der persönliche Wandel, den die Ereignisse in Mali hervorgerufen haben. Sie hätten ihn politisiert, berichtet Kouyaté in einem Interview. Das Ergebnis ist hörbar: Er verurteilt den Putsch und hat als Aufruf zu Frieden und Toleranz auf zur «Jama ko» geladen, zur «großen Versammlung». Das Titelstück hat er mit Musikern aller Ethnien und Religionen eingespielt.
Das Album ist von treibenden Stücken geprägt. Kouyaté selbst zeigt sich wieder ungemein virtuos, und neben seiner Frau Amy Sacko singen Zoumana Tereta, Khaira Arby und Kassé Mady Diabaté. Seine Band – mittlerweile sind seine beiden Söhne Mamadou und Moustafa dabei – wird für fast jedes Stück um Gastmusiker erweitert, vor allem um einheimische Balafon- und Ngoni-Virtuosen, aber auch um die kanadischen Folkmusiker Andrew und Brad Barr.
«Jama ko» zeigt, dass man das Rad nicht immer neu erfinden muss, aber in jeder Erfindung Entwicklungspotenzial steckt – Bassekou Kouyaté tüftelt erfolgreich weiter.
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 20. Mai 2013
Charles Bradley – Victim Of Love
thenoise, 15:11h
 Seine Geschichte ist anrührend, und wer nicht glaubt, dass nur Leid und Schmerz einen Sänger zum Soulman formen, findet in der Lebensgeschichte von Charles Bradley einen Grund zu konvertieren. Der in armen Verhältnissen aufgewachsene Mittsechziger hat sein Debütalbum vor drei Jahren aufgenommen. Jetzt legt er nach. Nicht mehr ganz so düster und verzweifelt, sondern mit einem Hoffnungsschimmer – in den er aber immer noch eine gute Portion Sehnsucht und Schmerz legt. Die langen Jahre des Schmerzes wischt auch die große Zuneigung nicht weg, die ihm seit dem Erscheinen Seines Debütalbums vor drei Jahren entgegengebracht wird.
Seine Geschichte ist anrührend, und wer nicht glaubt, dass nur Leid und Schmerz einen Sänger zum Soulman formen, findet in der Lebensgeschichte von Charles Bradley einen Grund zu konvertieren. Der in armen Verhältnissen aufgewachsene Mittsechziger hat sein Debütalbum vor drei Jahren aufgenommen. Jetzt legt er nach. Nicht mehr ganz so düster und verzweifelt, sondern mit einem Hoffnungsschimmer – in den er aber immer noch eine gute Portion Sehnsucht und Schmerz legt. Die langen Jahre des Schmerzes wischt auch die große Zuneigung nicht weg, die ihm seit dem Erscheinen Seines Debütalbums vor drei Jahren entgegengebracht wird.Ausdrucksstark heult der frühere James-Brown-Imitator wie weiland sein Vorbild. Die Musik ist die Reinkarnation des Soul der 60er-/70er-Jahre und verströmt noch immer die Authentizität von damals. Hinter der ausdrucksstarken Stimme des immer wieder wie James Brown kreischenden Charles Bradley werden die Songs durchweg mit wohlkalkulierten Bläsersätzen der Menahan Street Band und wohlklingenden Uh-Uh-Oh-Oh-Einwürfe des Chors akzentuiert. Die Hammond-Orgel – mal dramatisierend, dann wieder mit hüpfender Leichtigkeit – fehlt ebenso wenig die mit viel Hall unterlegte Gitarre und kleine Überraschungen wie die folkige Gitarre im Titelstück «Victim Of Love».
Aber Charles Bradley singt nicht nur von der Liebe, die ihn stärkt oder leiden lässt, sondern kommentiert – natürlich aus der Sicht des Underdogs – die Stimmung der Zeit. Und auch wenn er die Musik von gestern wieder aufleben lässt: Seine Botschaften sind für das Hier und Jetzt.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 19. Mai 2013
Rosalie und Wanda - Meister Hora
thenoise, 11:14h
 Mit seinem Roman «Momo» hat Michael Ende einen Roman geschrieben, der – ähnlich wie Antoine de Saint-Exupérys “Der kleine Prinz” – trotz seiner einfachen Sprache einem gewissen Tiefgang nicht entbehrt. Es ist also keineswegs infantil, wenn Rosalie Eberle mit dem Titelstück dem Hüter der Zeit in Michael Endes Roman die Referenz erweist. Es passt zudem, weil auch die Musik von Rosalie Eberle einfach ist. Und es ist nicht falsch, obwohl ihre Texte keine poetisierten Erläuterungen philosophischer Standpunkte sind. Dafür sind sie durchweg mit dem Impetus geschrieben, mehr als unterhaltend sein zu wollen.
Mit seinem Roman «Momo» hat Michael Ende einen Roman geschrieben, der – ähnlich wie Antoine de Saint-Exupérys “Der kleine Prinz” – trotz seiner einfachen Sprache einem gewissen Tiefgang nicht entbehrt. Es ist also keineswegs infantil, wenn Rosalie Eberle mit dem Titelstück dem Hüter der Zeit in Michael Endes Roman die Referenz erweist. Es passt zudem, weil auch die Musik von Rosalie Eberle einfach ist. Und es ist nicht falsch, obwohl ihre Texte keine poetisierten Erläuterungen philosophischer Standpunkte sind. Dafür sind sie durchweg mit dem Impetus geschrieben, mehr als unterhaltend sein zu wollen.Ihre Betrachtung der Welt wirkt arglos und staunend, und natürlich schreibt Rosalie Eberle ausgiebig über die Liebe, die ebenso selbstverständlich schön und schwer ist. Sie beschreibt ihre Empfindungen in einfachen Worten, findet jedoch ganz eigene, leicht verschrobene Ideen und Formulierungen. So will sie mit ihrem Liebsten einen Apfelbaum pflanzen «am schönsten Ort, an dem er Platz hat zum Tanzen», denn «Jahr für Jahr stellt er die Liebe dar» singt sie und beschreibt damit gleichzeitig, dass eine Beziehung nicht nur die Frühlingsblüte, sondern auch den kargen Winter kennt.
Die folkigen Lieder werden passend interpretiert, wobei Rosalie Eberle und ihre Begleiter Manfred Mildenberger (Schlagzeug, Bass, Keyboards) und Sascha Biebergeil (Gitarre) gängige Muster bevorzugen. Dann setzt in «Apfelbaum» die Slide-Gitarre genau an der Stelle ein, an der man sie erwartet.
Die luftigen, mit anheimelnder Stimme gesungenen Lieder von Rosalie Eberle sind Ohrwürmer – aber nicht von der nervigen Art, die man den ganzen Tag verzweifelt abzuschütteln versucht. Sie sind, auch bei der leichten Schwermut, der sie mitunter durchzieht, dazu angetan, den Tag leichter zu machen.
... link (0 Kommentare) ... comment
... nächste Seite