Sonntag, 4. Dezember 2011
Steve Earle - I'll Never Get Out of This World Alive
thenoise, 11:44h
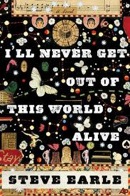 Viel tiefer kann Doc nicht mehr sinken: Der Junkie hat Approbation und Praxis verloren und hält seine Sprechstunde in einer Kneipe ab, die auch seine Kunden bevölkern - Prostituierte, die abtreiben wollen, und Gangster, die sich mit ihren Schuss- und Stichwunden in kein Krankenhaus wagen können. Eine seine minderjährigen Kundinnen, die von ihrem Liebhaber schwanger sitzen gelassene Graciela, bleibt mangels Alternative bei ihm. Doc und die illiegal in den USA wohnende Mexikanerin werden ein unschlagbares Team. Denn Graciela ist Wunderheilerin. Wer von ihr in größter Not mit Gebeten und Sprüchen bedacht wird, ist im Nu wie umgedreht. Prostituierte krempeln ihr Leben für einen Neuanfang um, und die Süchtigen werden clean. Selbst Doc, der tiefer nicht mehr hätte sinken können, lässt von den Drogen ab. Und auch seinen Dealer packt plötzlich die Lust auf einen Neuanfang.
Viel tiefer kann Doc nicht mehr sinken: Der Junkie hat Approbation und Praxis verloren und hält seine Sprechstunde in einer Kneipe ab, die auch seine Kunden bevölkern - Prostituierte, die abtreiben wollen, und Gangster, die sich mit ihren Schuss- und Stichwunden in kein Krankenhaus wagen können. Eine seine minderjährigen Kundinnen, die von ihrem Liebhaber schwanger sitzen gelassene Graciela, bleibt mangels Alternative bei ihm. Doc und die illiegal in den USA wohnende Mexikanerin werden ein unschlagbares Team. Denn Graciela ist Wunderheilerin. Wer von ihr in größter Not mit Gebeten und Sprüchen bedacht wird, ist im Nu wie umgedreht. Prostituierte krempeln ihr Leben für einen Neuanfang um, und die Süchtigen werden clean. Selbst Doc, der tiefer nicht mehr hätte sinken können, lässt von den Drogen ab. Und auch seinen Dealer packt plötzlich die Lust auf einen Neuanfang. Steve Earle bemüht sich redlich, seinen Roman mit skurrilen Figuren zu bevölkern. So stehen auch Dialoge mit dem Geist von Hank Williams im Zentrum. Den Musiker hatte Doc zu Lebzeiten behandelt. Dazu gibt es noch die üblichen Verdächtigen abgerissener Szenerien, etwa den coolen Drogendealer, Paradejunkies und einen Transverstiten oder auch den korrupten Polizist. Das sind Stereotype, die genauso gezeichnet werden. Mehr als ein paar mäßig unterhaltende Stunden bietet Steve Earle nicht. Weder schreibt er packend, noch erzählt er durchgeknallt und grotesk wie etwa T.C. Boyle. Der hätte daraus eine tragigkomische Geschichte mit permantenten Wechselbädern zwischen Beklemmung und Tränenlachen gemacht. Doch dafür fehlt es Steve Earle an Ideenreichtum und Sprachmacht.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 21. August 2011
Peter Schanz - 87 Tage blau
thenoise, 10:53h
 Viele Farben blau hat Peter Schanz auf seiner Weltreise gesehen. In 87 Tagen hat er die Welt auf einem Frachtschiff umrundet. Fotografiert hat er nicht Kapitän und Koch, nicht das Leben auf dem Schiff und auch nicht Container und Kajüte. Festgehalten hat er dafür umso konsequenter das Wasser: mal tiefblau, mal grün, mal flach wie eine Leinwand und dann wieder mit gischtgekräuselten Wellen.
Viele Farben blau hat Peter Schanz auf seiner Weltreise gesehen. In 87 Tagen hat er die Welt auf einem Frachtschiff umrundet. Fotografiert hat er nicht Kapitän und Koch, nicht das Leben auf dem Schiff und auch nicht Container und Kajüte. Festgehalten hat er dafür umso konsequenter das Wasser: mal tiefblau, mal grün, mal flach wie eine Leinwand und dann wieder mit gischtgekräuselten Wellen.Auch wenn es längst nicht mehr ungewöhnlich ist, die Meere als Gast auf einem Frachtschiff zu überqueren, ist «87 Tage blau» in jeder Hinsicht ein besonderes Reisetagebuch. Das liegt am einzigen Sujet des Buches, dem Wasser. Es liegt aber ebenso an den kurzen tagebuchartigen poetischen Betrachtungen des Autors, die gleichberechtigt neben den Bildern stehen. Mal erzählt Schanz vom Leben an Bord, dann wieder mit Sachinformationen angereicherte Reiseeindrücke oder Reflektionen. Die Texte sind überaus kurz unter einem für einen Bildband vergleichsweise kleinen Aufnahmen – Amuse bouche, an denen man sich nach und nach satt-sehen und auch satt-lesen kann.
... link (2 Kommentare) ... comment
Sonntag, 9. Januar 2011
Das Lebensgefühl an der Schnittstelle von Orient und Okzident
Andreas Herzau fotografiert das Leben in Istanbul
Andreas Herzau fotografiert das Leben in Istanbul
thenoise, 22:42h
 Seit einigen Jahren zählt Istanbul zu den angesagten Metropolen der Welt. An der Schnittstelle von Orient und Okzident gelegen, bietet es eine lebendige Kunstszene, die Clubkultur, die sich junge Europäer wünschen, und – selbst wenn man im Ausgeh-Viertel Beyoglu keinen Muezzin rufen hört – die notwendige Dosis Exotik. Der türkischstämmige Regisseur Fatih Akin hat mit seinen Filmen „Gegen die Wand“ und „Auf der anderen Seite“ sowie dem Musikfilm „Crossing the Bridge“ kräftig dabei mitgeholfen, die Stadt und ihre (Jugend)Kultur bei uns bekannt zu machen.
Seit einigen Jahren zählt Istanbul zu den angesagten Metropolen der Welt. An der Schnittstelle von Orient und Okzident gelegen, bietet es eine lebendige Kunstszene, die Clubkultur, die sich junge Europäer wünschen, und – selbst wenn man im Ausgeh-Viertel Beyoglu keinen Muezzin rufen hört – die notwendige Dosis Exotik. Der türkischstämmige Regisseur Fatih Akin hat mit seinen Filmen „Gegen die Wand“ und „Auf der anderen Seite“ sowie dem Musikfilm „Crossing the Bridge“ kräftig dabei mitgeholfen, die Stadt und ihre (Jugend)Kultur bei uns bekannt zu machen. Das grossformatige Buch von Andreas Herzau ist eine Reportage in Bildern. Er fotografiert die Taubenfuttermittelverkäuferin vor der Yeni-Moschee, Menschen beim Warten und im Café, freizügige Werbung auf einem Bus und Gläubige beim Waschen ihrer Füsse vor dem Gebet. Viele Bilder wirken wie beiläufig entstandene Schnappschüsse. Sie sind gelegentlich recht roh, manche haben keinen eindeutigen Schärfebereich. Schwarzweiss-Aufnahmen durchbrechen die überwiegend farbigen Fotos.
Dem Mainzer Fotograf geht es um die Vermittlung von Stimmungen. Er zeigt seine persönliche Sicht der Stadt und nicht die eines Reiseführers. Er bringt viele Alltagsszenen, Menschen in den Strassen oder die aufgereihten Schuhe eines Strassenverkäufers. Seine bei den Streifzügen durch die Stadt entstandenen Bilder benennt er nach Stadtteilen, und nicht etwa nach dem Lokal, in dem er fotografiert hat, nicht nach der abgebildeten Moschee und auch nicht nach der portraitierten Person.
Natürlich kann man sich fragen, warum er nur ein Bild aus dem touristischen Sultanahmet-Viertel bringt, das nicht nur touristische Motive bietet, und wieso er so oft in Eminönü herumgestrichen ist und nicht auch mal Ortaköy, wo früher viele Armenier wohnten. Aber solche, oft von persönlichen Vorlieben geprägten Wünschen muss Andreas Herzau natürlich nicht entsprechen. Er ist seiner eigenen Route, seinem eigenen Spürsinn gefolgt. Und das ist gut so. Denn was zählt, ist, dass er mit seiner Sicht der Stadt ihr Lebensgefühl transportiert. Und das gelingt ihm zweifellos.
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 11. September 2010
Henry Leutwyler - Michael Jackson
thenoise, 17:34h
 «Ich wollte eine andere Seite von Michael Jackson zeigen. Ich wollte ihn wieder auf den Boden bringen und den Mann zeigen, der er war. Einer, der Schweiß- und Makeup-Spuren auf seiner Wäsche hinterlässt», sagte der People-Fotograf Henry Leutwyler zu seinen Bildern. Dafür hat er Gegenstände des Künstlers abgebildet, die in einer Auktion versteigert werden sollten: den legendären weißen Handschuh, Kostüme, eine abgegriffene, alte Peter-Pan-Ausgabe, Putten und Nippes. Leutwyler, eigentlich People-Fotograf, wählte für die Sachaufnahmen eher unbewusst einen schwarzen Hintergrund, der die Farben noch mehr strahlen lässt.
«Ich wollte eine andere Seite von Michael Jackson zeigen. Ich wollte ihn wieder auf den Boden bringen und den Mann zeigen, der er war. Einer, der Schweiß- und Makeup-Spuren auf seiner Wäsche hinterlässt», sagte der People-Fotograf Henry Leutwyler zu seinen Bildern. Dafür hat er Gegenstände des Künstlers abgebildet, die in einer Auktion versteigert werden sollten: den legendären weißen Handschuh, Kostüme, eine abgegriffene, alte Peter-Pan-Ausgabe, Putten und Nippes. Leutwyler, eigentlich People-Fotograf, wählte für die Sachaufnahmen eher unbewusst einen schwarzen Hintergrund, der die Farben noch mehr strahlen lässt.Die 'unglaubliche Traurigkeit' ausstrahlenden 'Artefakte einer verlorenen Jugend' würden mehr über die Person des Musikers aussagen als ein Porträt von ihm, behauptet der Schweizer Fotograf. Das mag weit hergeholt sein, denn die Bilder sind letztlich Sachaufnahmen, wie man sie in jedem Auktionskatalog finden kann. Auch die von Leutwyler fotografierten Gegenstände waren für eine Auktion bestimmt. Michael Jackson konnte sie mit dem Vorschuss für die in London angekündigten Konzerte wieder auslösen. Die Interpretation des Schweizer Fotografen - «Für ihn war das wohl so, als ob er seine Jugend und Kindheit zum zweiten Mal verloren hatte» - klingt nur bedingt stimmig. Denn zumeist sind Bühnenkleidung und Accessoires abgebildet und nicht Gegenstände aus Jacksons Jugendzeit.
Doch egal, wie man die Ergebnisse interpretiert: Henry Leutwyler bietet mit seinen makellosen Bildern einen ungewöhnlichen Zugang zur Person Michael Jackson. Der Rest ist Interpretation.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 22. August 2010
Joachim Geil - Heimaturlaub
thenoise, 11:17h
Es könnte so schön sein: eine Woche Urlaub im idyllischen Schwarzwald, bei der Großmutter, den Freunden – und vor allem bei Heidi, in die Dieter Thomas schon lange verliebt ist. Diese Woche wird er nutzen, um sie für sich zu gewinnen. Da ist er – trotz aller Nervosität – recht sicher, der schneidige, sympathische Leutnant, der auch im Heimaturlaub nur absolut korrekt gekleidet mit bis zum obersten Knopf geschlossener Uniformjacke auf die Strasse geht.
Seine Verletzung aus dem Russlandfeldzug sieht man ihm nicht mehr an. Zwischen Lazarett und Rückkehr an die Front verbringt er sieben flirrend heisse Sommertage. Tage der Liebe sollen es werden. Tage am Abgrund erwarten ihn. Und das liegt nicht an Heidi, die seine Liebe erwidert.
Es sind die Kriegserinnerungen, die seine Erlebnisse überlagern. Und es ist die sonderbare Form des Sterbens, die ihn Zuhause erwartet. Das Haus ist still, die Stimmung gedrückt. Während an der Front der Tod rasch und überraschend kommt, liegt hier das Warten auf das Sterben des Grossvaters bedrückend in der Luft. Vielleicht lebt dieser nur noch, um seinem Enkel eine letzte Botschaft zu überbringen: dass der Krieg falsch ist, angezettelt von einem Satan, dem der Leutnant jetzt dient.
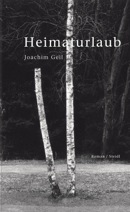 Langsam, mit der Gewissheit, dass der Schmerz es von ihr verlangt, langsam zu sein, doch auch aus Erschöpfung, setzt die Grossmutter Löffel für Löffel an den Mund. Die Suppe ist dünn, aber die Kartoffeln sind zu schmecken.
Langsam, mit der Gewissheit, dass der Schmerz es von ihr verlangt, langsam zu sein, doch auch aus Erschöpfung, setzt die Grossmutter Löffel für Löffel an den Mund. Die Suppe ist dünn, aber die Kartoffeln sind zu schmecken.
Prima, sagt Dieter und lächelt Tante Emmy an, als sie ihm einen Nachschlag gibt. Die Grossmutter schweigt, und auch Dieter wagt es nicht, mit der Bemerkung herauszuplatzen, dass die Bahnfahrt ohne Verspätung vonstatten gegangen sei und der Anschluss in Winden direkt geklappt habe. Die Strenge, mit der Großmutters Kleid am Hals bis zum Kinn geschlossen ist, lässt Dieter an seine Uniform denken, deren obersten Knopf er noch immer nicht geöffnet hat. Die auf der Verandamauer stehenden Blumen duften still und dumpf, und es liegt etwas in der Luft, was er in ganz anderer Form tagtäglich in Einzelteilen und aufgerissenen Mündern voller Energie oder als beiläufiges Umkippen und Vornüberfallen, Zurseitesacken, Liegenbleiben im Zischen und Pfeifen oder als rückkehrloses Fernbleiben registriert hat. Es liegt der Tod in der Luft, mit einer Schwere, die Dieter nicht kennt, die er sich nicht vorstellen kann, nicht vorstellen will, denn was ist so Besonderes an ihm? Dieter sieht die in die Suppe blickende Grossmutter an und merkt, dass hier anders gestorben wird. Der Tod hat hier etwas Getragenes und Besonderes, hier wird ein Tod gestorben, der sich ankündigt und alle in seinen Bann zieht.
Joachim Geil hat als Vierzigjähriger seinen Debütroman veröffentlich – und damit einen fulminanten Einstieg hingelegt. «Heimaturlaub» erzählt eine mitreißende Geschichte mit überraschenden Wendungen; sie ist lebendig geschrieben und originell konzipiert. Geil erfindet einen Erzähler, der als Nachfahre von Leutnant Dieter Thomas dessen Kriegstagebuch mit seinen nüchternen bis nichtssagenden Eintragungen findet und dessen Lebensgeschichte rekonstruiert.
Sein Roman geht nur am Rand auf die Unmenschlichkeiten des Nazi-Regimes ein, indem er an einem dramatischen Beispiel – Dieters Onkel denunziert seinen Grossvater – die denunziatorische Stimmung aufgreift. Sonst bleibt er als Erzähler durchweg neutral. Er urteilt nicht, sondern berichtet nüchtern, wie Dieter Thomas – von den Grosseltern aufgefordert zu desertieren – wieder zurück in den Krieg geht und fällt. Was seine Verwandten ebensowenig wissen wie seine Geliebte Heidi: Der Tod ist nicht Pflichterfüllung, er ist auch der einzige Ausweg von den schaurigen Kriegserinnerungen, die ihn selbst tagsüber und im romantischen Beisammensein mit seiner Geliebten überkommen und die der Autor eindrücklich drastisch beschreibt.
Seine Verletzung aus dem Russlandfeldzug sieht man ihm nicht mehr an. Zwischen Lazarett und Rückkehr an die Front verbringt er sieben flirrend heisse Sommertage. Tage der Liebe sollen es werden. Tage am Abgrund erwarten ihn. Und das liegt nicht an Heidi, die seine Liebe erwidert.
Es sind die Kriegserinnerungen, die seine Erlebnisse überlagern. Und es ist die sonderbare Form des Sterbens, die ihn Zuhause erwartet. Das Haus ist still, die Stimmung gedrückt. Während an der Front der Tod rasch und überraschend kommt, liegt hier das Warten auf das Sterben des Grossvaters bedrückend in der Luft. Vielleicht lebt dieser nur noch, um seinem Enkel eine letzte Botschaft zu überbringen: dass der Krieg falsch ist, angezettelt von einem Satan, dem der Leutnant jetzt dient.
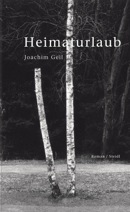 Langsam, mit der Gewissheit, dass der Schmerz es von ihr verlangt, langsam zu sein, doch auch aus Erschöpfung, setzt die Grossmutter Löffel für Löffel an den Mund. Die Suppe ist dünn, aber die Kartoffeln sind zu schmecken.
Langsam, mit der Gewissheit, dass der Schmerz es von ihr verlangt, langsam zu sein, doch auch aus Erschöpfung, setzt die Grossmutter Löffel für Löffel an den Mund. Die Suppe ist dünn, aber die Kartoffeln sind zu schmecken.Prima, sagt Dieter und lächelt Tante Emmy an, als sie ihm einen Nachschlag gibt. Die Grossmutter schweigt, und auch Dieter wagt es nicht, mit der Bemerkung herauszuplatzen, dass die Bahnfahrt ohne Verspätung vonstatten gegangen sei und der Anschluss in Winden direkt geklappt habe. Die Strenge, mit der Großmutters Kleid am Hals bis zum Kinn geschlossen ist, lässt Dieter an seine Uniform denken, deren obersten Knopf er noch immer nicht geöffnet hat. Die auf der Verandamauer stehenden Blumen duften still und dumpf, und es liegt etwas in der Luft, was er in ganz anderer Form tagtäglich in Einzelteilen und aufgerissenen Mündern voller Energie oder als beiläufiges Umkippen und Vornüberfallen, Zurseitesacken, Liegenbleiben im Zischen und Pfeifen oder als rückkehrloses Fernbleiben registriert hat. Es liegt der Tod in der Luft, mit einer Schwere, die Dieter nicht kennt, die er sich nicht vorstellen kann, nicht vorstellen will, denn was ist so Besonderes an ihm? Dieter sieht die in die Suppe blickende Grossmutter an und merkt, dass hier anders gestorben wird. Der Tod hat hier etwas Getragenes und Besonderes, hier wird ein Tod gestorben, der sich ankündigt und alle in seinen Bann zieht.
Joachim Geil hat als Vierzigjähriger seinen Debütroman veröffentlich – und damit einen fulminanten Einstieg hingelegt. «Heimaturlaub» erzählt eine mitreißende Geschichte mit überraschenden Wendungen; sie ist lebendig geschrieben und originell konzipiert. Geil erfindet einen Erzähler, der als Nachfahre von Leutnant Dieter Thomas dessen Kriegstagebuch mit seinen nüchternen bis nichtssagenden Eintragungen findet und dessen Lebensgeschichte rekonstruiert.
Sein Roman geht nur am Rand auf die Unmenschlichkeiten des Nazi-Regimes ein, indem er an einem dramatischen Beispiel – Dieters Onkel denunziert seinen Grossvater – die denunziatorische Stimmung aufgreift. Sonst bleibt er als Erzähler durchweg neutral. Er urteilt nicht, sondern berichtet nüchtern, wie Dieter Thomas – von den Grosseltern aufgefordert zu desertieren – wieder zurück in den Krieg geht und fällt. Was seine Verwandten ebensowenig wissen wie seine Geliebte Heidi: Der Tod ist nicht Pflichterfüllung, er ist auch der einzige Ausweg von den schaurigen Kriegserinnerungen, die ihn selbst tagsüber und im romantischen Beisammensein mit seiner Geliebten überkommen und die der Autor eindrücklich drastisch beschreibt.
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 5. April 2010
Plädoyer für eine unterschätzte Kulturtechnik
Kathrin Passig und Aleks Scholz propagieren das Verirren
Kathrin Passig und Aleks Scholz propagieren das Verirren
thenoise, 14:17h
Man kann leicht provozieren, indem man das Gegenteil von dem propagiert, was als allgemeingültig anerkannt ist. Kathrin Passig beherrscht dieses Prinzip. Vor zwei Jahren hat sie gemeinsam mit Sascha Lobo ein Buch veröffentlicht, das der Prokrastination huldigt. Prokrastination ist die Kunst des Aufschiebens, von den meisten Menschen eher als Krankheit empfunden. Während alle Welt findet, man müsse noch besser organisiert sein, man müsse alles Anfallende sofort erledigen, zelebrieren die beiden Autoren genüsslich die Vorteile des Unperfekten. Jetzt legt Kathrin Passig – auf einem anderen Gebiet und mit einem anderen Partner – nach: Mit einer Anleitung zum Verirren. Das klingt, nicht nur im Zeitalter von GPS und Navigationsgeräten mit dreidimensionalen Bildern paradox.
Warum aber sollte sich jemand mit dem Verirren auseinandersetzen, wenn er nicht gerade eine Wüstendurchquerung plant oder auf Händen zum Südpol möchte? Die Autoren verraten es erst am Ende ihres durchweg vergnüglich zu lesenden Buches.
 Insgeheim geht es beim Verirren, so schreiben die Autoren, um Grundfragen der Wissenschaft, um Problemlösungsstrategien, um Einsichten in Erkenntnisprozesse. Welche Einflüsse tragen dazu bei, im Menschen Ideen entstehen zu lassen, richtige wie falsche? Auf welcher Grundlage können wir beurteilen, ob uns diese Ideen ans Ziel führen? Wie ist es möglich, den Überblick darüber zu behalten, was man weiß und vor allem: was man nicht weiß? Kann derselbe verwirte Kopf, der einen Fehler gemacht hat, diesen Fehler erkennen und sich quasi an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen? In ihrem Wesen verhalten sich Verirrte und Wissenschaftler ähnlich – was damit zu tun hat, dass Menschen zur Problemlösung ähnliche Methoden einsetzen, egal, in welcher Form sich die Probleme stellen.
Insgeheim geht es beim Verirren, so schreiben die Autoren, um Grundfragen der Wissenschaft, um Problemlösungsstrategien, um Einsichten in Erkenntnisprozesse. Welche Einflüsse tragen dazu bei, im Menschen Ideen entstehen zu lassen, richtige wie falsche? Auf welcher Grundlage können wir beurteilen, ob uns diese Ideen ans Ziel führen? Wie ist es möglich, den Überblick darüber zu behalten, was man weiß und vor allem: was man nicht weiß? Kann derselbe verwirte Kopf, der einen Fehler gemacht hat, diesen Fehler erkennen und sich quasi an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen? In ihrem Wesen verhalten sich Verirrte und Wissenschaftler ähnlich – was damit zu tun hat, dass Menschen zur Problemlösung ähnliche Methoden einsetzen, egal, in welcher Form sich die Probleme stellen.
Das Buch ist eine Mischung aus Geschichten ums Verirren und Erkenntnissen. An unterschiedlichen Berichten von Menschen, die sich verirrt haben und wieder gerettet wurden, zeigen die Autoren beispielhaft, worauf es ankommt. Als Beispiele dienen die Geschichten von unachtsamen Menschen, die mit ihrem Auto im Schnee stecken bleiben und fatale Fehler machen genauso wie Expeditionsberichte, etwa den von Hans Bertram und Adolf Klausmann. Die beiden Deutschen wollten mit ihrem Wasserflugzeug «Atlantis» von Deutschland nach Australien fliegen. Nachdem sie auf ihrer letzten Etappe, einem Nachtflug, durch ein Gewitter vom Kurs abkamen, mussten sie auf einer einsamen Insel notlanden und erst nach rund 40 Tagen zufällig gefunden werden.
Auch wenn es komisch klingt. Das Buch «Verirren» ist alltagstauglich – aus mehreren Gründen. Man erfährt einiges über das Verhalten von Menschen, von denen manche die eigene Einschätzung bestätigen werden. Zum Beispiel, dass Männer weniger gut zugeben können, sich verirrt zu haben als Frauen, und dass sie dementsprechend lieber länger herumirren, als jemanden nach dem Weg zu fragen. Wer selbst gerne in unberührten Gegenden unterwegs ist, wird sein Augenmerk eher auf Hinweise zu Gefahr und Risikobewusstsein beherzigen und bedenken, dass die heutige Ausrüstung nicht zwangsläufig mehr Sicherheit bedeutet – sie verlockt eher zu riskanterem Verhalten. Risikoforscher schätzen, dass der Mensch bereit ist, bei freiwilligen Tätigkeiten wie Skifahren, Klettern oder Bergsteigen ein etwa tausend mal höheres Risiko zu akzeptieren als in Situationen, auf die er keinen Einfluss hat. Neben solchen durchaus nützlichen Informationen, die auch dazu anregen, das eigene Verhalten zu hinterfragen, erfährt man beispielsweise auch Wissenswertes, auf das man nicht so ohne weiteres stößt, etwa wie sich die polynesischen Seefahrer mit ihren Auslegerkanus in einem Gebiet orientiert haben, das 50 Millionen Quadratkilometer umfasst. Eine Fertigkeit übrigens, die – selbst wenn sie nicht im Lehrplan der Grundschule auftaucht – auch heute noch gelehrt wird.
Nicht zuletzt sitzt dem Autorenduo durchweg der Schalk im Nacken. Kathrin Passig und Aleks Scholz sind ständig zu einem Späßchen aufgelegt, und durch das ganze Werk zieht sich ein angenehm ironischer Ton. Beides trägt dazu bei, das Buch vergnüglich und lesenswert zu machen.
Warum aber sollte sich jemand mit dem Verirren auseinandersetzen, wenn er nicht gerade eine Wüstendurchquerung plant oder auf Händen zum Südpol möchte? Die Autoren verraten es erst am Ende ihres durchweg vergnüglich zu lesenden Buches.
 Insgeheim geht es beim Verirren, so schreiben die Autoren, um Grundfragen der Wissenschaft, um Problemlösungsstrategien, um Einsichten in Erkenntnisprozesse. Welche Einflüsse tragen dazu bei, im Menschen Ideen entstehen zu lassen, richtige wie falsche? Auf welcher Grundlage können wir beurteilen, ob uns diese Ideen ans Ziel führen? Wie ist es möglich, den Überblick darüber zu behalten, was man weiß und vor allem: was man nicht weiß? Kann derselbe verwirte Kopf, der einen Fehler gemacht hat, diesen Fehler erkennen und sich quasi an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen? In ihrem Wesen verhalten sich Verirrte und Wissenschaftler ähnlich – was damit zu tun hat, dass Menschen zur Problemlösung ähnliche Methoden einsetzen, egal, in welcher Form sich die Probleme stellen.
Insgeheim geht es beim Verirren, so schreiben die Autoren, um Grundfragen der Wissenschaft, um Problemlösungsstrategien, um Einsichten in Erkenntnisprozesse. Welche Einflüsse tragen dazu bei, im Menschen Ideen entstehen zu lassen, richtige wie falsche? Auf welcher Grundlage können wir beurteilen, ob uns diese Ideen ans Ziel führen? Wie ist es möglich, den Überblick darüber zu behalten, was man weiß und vor allem: was man nicht weiß? Kann derselbe verwirte Kopf, der einen Fehler gemacht hat, diesen Fehler erkennen und sich quasi an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen? In ihrem Wesen verhalten sich Verirrte und Wissenschaftler ähnlich – was damit zu tun hat, dass Menschen zur Problemlösung ähnliche Methoden einsetzen, egal, in welcher Form sich die Probleme stellen.Das Buch ist eine Mischung aus Geschichten ums Verirren und Erkenntnissen. An unterschiedlichen Berichten von Menschen, die sich verirrt haben und wieder gerettet wurden, zeigen die Autoren beispielhaft, worauf es ankommt. Als Beispiele dienen die Geschichten von unachtsamen Menschen, die mit ihrem Auto im Schnee stecken bleiben und fatale Fehler machen genauso wie Expeditionsberichte, etwa den von Hans Bertram und Adolf Klausmann. Die beiden Deutschen wollten mit ihrem Wasserflugzeug «Atlantis» von Deutschland nach Australien fliegen. Nachdem sie auf ihrer letzten Etappe, einem Nachtflug, durch ein Gewitter vom Kurs abkamen, mussten sie auf einer einsamen Insel notlanden und erst nach rund 40 Tagen zufällig gefunden werden.
Auch wenn es komisch klingt. Das Buch «Verirren» ist alltagstauglich – aus mehreren Gründen. Man erfährt einiges über das Verhalten von Menschen, von denen manche die eigene Einschätzung bestätigen werden. Zum Beispiel, dass Männer weniger gut zugeben können, sich verirrt zu haben als Frauen, und dass sie dementsprechend lieber länger herumirren, als jemanden nach dem Weg zu fragen. Wer selbst gerne in unberührten Gegenden unterwegs ist, wird sein Augenmerk eher auf Hinweise zu Gefahr und Risikobewusstsein beherzigen und bedenken, dass die heutige Ausrüstung nicht zwangsläufig mehr Sicherheit bedeutet – sie verlockt eher zu riskanterem Verhalten. Risikoforscher schätzen, dass der Mensch bereit ist, bei freiwilligen Tätigkeiten wie Skifahren, Klettern oder Bergsteigen ein etwa tausend mal höheres Risiko zu akzeptieren als in Situationen, auf die er keinen Einfluss hat. Neben solchen durchaus nützlichen Informationen, die auch dazu anregen, das eigene Verhalten zu hinterfragen, erfährt man beispielsweise auch Wissenswertes, auf das man nicht so ohne weiteres stößt, etwa wie sich die polynesischen Seefahrer mit ihren Auslegerkanus in einem Gebiet orientiert haben, das 50 Millionen Quadratkilometer umfasst. Eine Fertigkeit übrigens, die – selbst wenn sie nicht im Lehrplan der Grundschule auftaucht – auch heute noch gelehrt wird.
Nicht zuletzt sitzt dem Autorenduo durchweg der Schalk im Nacken. Kathrin Passig und Aleks Scholz sind ständig zu einem Späßchen aufgelegt, und durch das ganze Werk zieht sich ein angenehm ironischer Ton. Beides trägt dazu bei, das Buch vergnüglich und lesenswert zu machen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 28. Februar 2010
T. C. Boyle - Zähne und Klauen
thenoise, 13:21h
Bei vielen Büchern reicht es völlig, wenn man auf die Taschenbuchausgabe wartet. Bis zu deren Erscheinen hat sich - wie bei den unverzichtbaren Zeitungsartikeln, die man einige Wochen später oft ungelesen wegschmeißt - die Dringlichkeit relativiert oder es sind ohnehin zeitlose Geschichten, die nur auf die passende Gestimmtheit der Lesenden warten. T. C. Boyles Erzählband «Zähne und Klauen» pendelt dazwischen. Wie immer sprachmächtig und mit überbordender Fantasie erzählt er überwiegend von Menschen am Rand des gesellschaftlichen Abgrunds. Da ist der coole Lehrer auf der Schwelle zur Heroinsucht oder der von seiner Freundin Verlassene an der Kippe zum Pennerdasein. Es gibt aber auch die "normalen" vom Pech verfolgten, die zum Beispiel die unheilbare Krankheit der Ehefrau aus der Bahn zu werfen droht.
Die Erzählungen in «Zähne und Klauen» sind sicherlich nicht die besten des Autors, aber noch immer eine Klasse für sich.
Die Erzählungen in «Zähne und Klauen» sind sicherlich nicht die besten des Autors, aber noch immer eine Klasse für sich.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 14. Februar 2010
Ode an die Cover-Art
Der Wind, das Licht. ECM und das Bild macht Lust aufs Hören
Der Wind, das Licht. ECM und das Bild macht Lust aufs Hören
thenoise, 22:47h
Dies ist ohne Zweifel der schönste Katalog, den ich je gesehen habe. Ein bibliophiler Bilderrausch, zum Schmökern, um Lust auf Musik zu bekommen. Er will nichts verkaufen. Der Wind, das Licht ist ein (ziemlich voluminöses) Kleinod für Anhänger des aus Produkt und Verpackung bestehenden musikalischen Gesamtkunstwerks. Wer dem großen Format der Langspielplattenhülle nachtrauert, weil das CD-Format keine Cover-Art mehr zulasse, findet hier die geballte Hilfe zur Überwindung seiner Vorurteile.
 Der prächtige Bildband ist aus Anlass des 40jährigen Jubiläums von Manfred Eichers Plattenfirma ECM (Edition of Contemporary Music) entstanden und bringt vor allem die Plattencover von 1996 bis heute (die Zeit von der Gründung im Jahre 1969 bis 1996 wird vom Band Sleeves of Desire abgedeckt, der ebenfalls im Lars-Müller-Verlag erschienen ist.)
Der prächtige Bildband ist aus Anlass des 40jährigen Jubiläums von Manfred Eichers Plattenfirma ECM (Edition of Contemporary Music) entstanden und bringt vor allem die Plattencover von 1996 bis heute (die Zeit von der Gründung im Jahre 1969 bis 1996 wird vom Band Sleeves of Desire abgedeckt, der ebenfalls im Lars-Müller-Verlag erschienen ist.)
Neben den Cover-Abbildungen werden manche Musiker in Schwarzweißfotografien gezeigt und immer wieder doppelseitige, atmosphärische Bilder.
Verschiedene Essays, die der Faszination der Cover-Gestaltung auf die Spur kommen möchten, begleiten die opulente Bilderflut. Thomas Steinfeld, Leiter Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und der Pianist Ketil Bjørnstad bewundern neben anderen Aspekten die Zeitlosigkeit der Bilder. Die Kunsthistorikerin Katharina Epprecht erkennt in ihnen Transmediale Sinnbilder und bemerkt, dass die äußere Erscheinung der Alben zur Konzentration auf das Wesentliche hinführt, während der britische Filmspezialist Geoff Andrew dem Verhältnis der Filme von Jean-Luc Godard und Labelchef Manfred Eicher auf den Grund geht. ECM veröffentlichte nicht nur Filme des französischen Regisseurs und den Soundtrack zu Nouvelle Vague (1997), sondern setzt Film-Stills auch für Plattencover ein.
Durch ihre eigenständige Bildsprache bzw. Grafik sind die Plattenhüllen von ECM so unverwechselbar wie bei kaum einem anderen Label. Trotz allem künstlerischen Anspruch erfüllen die Bilder ihre werberische Aufgabe und machen Lust auf mehr. Man möchte die Musik sofort hören, bemerkte eine Besucherin nach kurzem Blättern in Der Wind, das Licht. Wohl dem, der dann nur noch zum CD-Regal gehen und nicht mehr allzuviel nachkaufen muss...
 Der prächtige Bildband ist aus Anlass des 40jährigen Jubiläums von Manfred Eichers Plattenfirma ECM (Edition of Contemporary Music) entstanden und bringt vor allem die Plattencover von 1996 bis heute (die Zeit von der Gründung im Jahre 1969 bis 1996 wird vom Band Sleeves of Desire abgedeckt, der ebenfalls im Lars-Müller-Verlag erschienen ist.)
Der prächtige Bildband ist aus Anlass des 40jährigen Jubiläums von Manfred Eichers Plattenfirma ECM (Edition of Contemporary Music) entstanden und bringt vor allem die Plattencover von 1996 bis heute (die Zeit von der Gründung im Jahre 1969 bis 1996 wird vom Band Sleeves of Desire abgedeckt, der ebenfalls im Lars-Müller-Verlag erschienen ist.)Neben den Cover-Abbildungen werden manche Musiker in Schwarzweißfotografien gezeigt und immer wieder doppelseitige, atmosphärische Bilder.
Verschiedene Essays, die der Faszination der Cover-Gestaltung auf die Spur kommen möchten, begleiten die opulente Bilderflut. Thomas Steinfeld, Leiter Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und der Pianist Ketil Bjørnstad bewundern neben anderen Aspekten die Zeitlosigkeit der Bilder. Die Kunsthistorikerin Katharina Epprecht erkennt in ihnen Transmediale Sinnbilder und bemerkt, dass die äußere Erscheinung der Alben zur Konzentration auf das Wesentliche hinführt, während der britische Filmspezialist Geoff Andrew dem Verhältnis der Filme von Jean-Luc Godard und Labelchef Manfred Eicher auf den Grund geht. ECM veröffentlichte nicht nur Filme des französischen Regisseurs und den Soundtrack zu Nouvelle Vague (1997), sondern setzt Film-Stills auch für Plattencover ein.
Durch ihre eigenständige Bildsprache bzw. Grafik sind die Plattenhüllen von ECM so unverwechselbar wie bei kaum einem anderen Label. Trotz allem künstlerischen Anspruch erfüllen die Bilder ihre werberische Aufgabe und machen Lust auf mehr. Man möchte die Musik sofort hören, bemerkte eine Besucherin nach kurzem Blättern in Der Wind, das Licht. Wohl dem, der dann nur noch zum CD-Regal gehen und nicht mehr allzuviel nachkaufen muss...
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 30. Januar 2010
Georg Kreisler - Letzte Lieder
thenoise, 12:12h
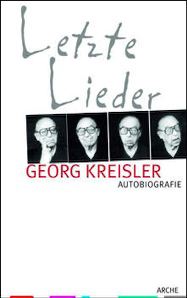 Georg Kreisler hadert mit seinen größten Erfolgen, bitter stimmt ihn, dass er noch immer wegen seiner kabarettistischen Lieder wie Taubenvergiften im Park und Wien ohne Wiener weitum bekannt ist, und nicht als Opernkomponist oder Bühnenautor. Dass der 87jährige weder an Bissigkeit verloren hat, noch die Altersmilde sein Leben sehnsüchtig verklärt, beweist er mit seiner Autobiographie Letzte Lieder.
Georg Kreisler hadert mit seinen größten Erfolgen, bitter stimmt ihn, dass er noch immer wegen seiner kabarettistischen Lieder wie Taubenvergiften im Park und Wien ohne Wiener weitum bekannt ist, und nicht als Opernkomponist oder Bühnenautor. Dass der 87jährige weder an Bissigkeit verloren hat, noch die Altersmilde sein Leben sehnsüchtig verklärt, beweist er mit seiner Autobiographie Letzte Lieder. Die Genrebezeichnung ist generös gewählt. Denn Kreisler bringt mehr als seine Lebenserinnerungen - und die nicht beschönigend, sondern auch recht selbstkritisch. Kreisler lästert über künstlerischen Kleingeist und Kritiker, giftet gegen das Kulturestablishment in den Staaten und gegen die Österreicher. Dabei geht es ihm nicht nur darum seine Lebensgeschichte zu erzählen, was er auch nicht besonders ausführlich tut. Seitenhiebe auf seinen einstigen Kollegen Gerhard Bronner oder seine ehemalige Gattin Topsy Küppers sind ihm wichtiger als die Erwähnung seiner Zusammenarbeit mit Charlie Chaplin. Mindestens genauso wichtig wie seine Lebensgeschichte sind ihm seine Gedanken zu Kunst und Musik, zur Kulturförderung, zum Antisemitismus oder zu Glauben und Religion. Dabei springt er munter zwischen den Zeiten und Themen hin und her - ganz so, als ob er am Tisch sitzen und erzählen würde. Auch die Letzten Lieder des altgedienten Künstlers, der sich selbstironisch als einfachen, hochkomplizierten Menschen bezeichnet, sind lebendig und frisch.
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 19. März 2009
Mark van Huisseling - Wie man berühmte Menschen trifft: 53 Gespräche mit Prominenten
thenoise, 11:15h
 Vermutlich würde Mark van Huisseling am liebsten nur über sich schreiben. Weil das aber niemand lesen würde, schreibt er über so genannte VIP-Anlässe und über andere Menschen. Selbst in seinen Interviews mit bemerkenswerten Zeitgenossen erfährt man über den Interviewer fast genauso viel wie über die Befragten. Mark van Huisseling ist – neudeutsch gesprochen – People-Journalist, also für Klatsch und Tratsch zuständig. Daher ist es eigentlich egal, mit wem er sich trifft und ob es um ein neues Parfüm geht oder um ein neues Buch. Denn darüber wird ohnehin nicht gesprochen.
Vermutlich würde Mark van Huisseling am liebsten nur über sich schreiben. Weil das aber niemand lesen würde, schreibt er über so genannte VIP-Anlässe und über andere Menschen. Selbst in seinen Interviews mit bemerkenswerten Zeitgenossen erfährt man über den Interviewer fast genauso viel wie über die Befragten. Mark van Huisseling ist – neudeutsch gesprochen – People-Journalist, also für Klatsch und Tratsch zuständig. Daher ist es eigentlich egal, mit wem er sich trifft und ob es um ein neues Parfüm geht oder um ein neues Buch. Denn darüber wird ohnehin nicht gesprochen. Die Mischung macht’s. Ob der Mensch, mit dem er sich trifft, nur prominent ist wie zum Beispiel Verena Pooth oder die ehemalige Pornodarstellerin Dolly Buster, oder ob sein Gesprächspartner wirklich Substanzielles zu sagen hätte, wie der Regisseur Christoph Schlingensief oder der Musiker Schorsch Kamerun: MvH, wie sich der Autor gerne nennt, unterläuft die Werbebemühungen seiner Gesprächspartner wie auch die gängige Interview-Form. Er verzichtet auf das übliche Frage-Antwort-Schema, sondern montiert die Aussagen in einen Text. Dieser ist jedoch kein Porträt seines Gegenübers, sondern eine Mischung aus reportageartigen Hinweisen auf die Situation, Zitate aus anderen Medien, mit denen er seine Gesprächspartner charakterisiert, eigenen Kommentaren und Assoziationen. Nicht zuletzt bringt er natürlich die Antworten seiner Interviewpartner, und mitunter verweist er sogar auf Gespräche mit anderen, zum Beispiel in der Niederschrift seines Gesprächs mit dem deutschen Maler Martin Eder.
Der Rockkritker Alan Bangs hat es mit seinen Texten tatsächlich auf die Bühne geschafft. Als er der J. Geils Band im Interview mit der ihm eigenen Unbescheidenheit unter die Nase rieb, der einzige Unterschied zwischen ihnen sei eigentlich der, dass man die Musiker bei der Ausübung ihrer künstlerischen Tätigkeit sehen könne, luden sie ihn prompt auf die Bühne ein, wo seine Schreibmaschine mit einem Mikro abgenommen wurde und er dann im Takt der Musik in die Tasten haute.
Vergleichbar unbescheiden ist auch van Huisseling, der es aber nur in die Jury eines Fernseh-Talentwettbewerbs gebracht hat. Zu seiner Ehrenrettung sei erwähnt, dass er dort gefeuert wurde, weil er als zu bösartig galt.
Auch wenn es der Werbetext abstreitet: Mark van Huisseling gefällt es, andere vorzuführen und als dumm darzustellen. Das macht durchaus Spaß, wenn man die eigenen Vorurteile pflegen möchte und bei Personen, mit denen man nie ein Interview lesen würde – mit dem Boxer René Weller, den Sängern Heino und Roberto Blanco, dem Kleidermacher Wolfgang Joop oder dem Fotomodell Gitta Saxx. Auch wenn er mit Harald Schmidt spricht, mit Schorsch Kamerun, Wim Wenders oder Marianne Faithfull ist das durchaus amüsant. Allerdings zeichnet er überwiegend Oberflächliches auf. Mark van Huisseling ist weit weg von er Qualität eines André Müller, der mit seinen ausführlichen Interviews das Wesen seiner Gesprächspartner facettenreich nahebringt. Diesen Anspruch kann van Huisseling nicht erfüllen. Seine Interviews müssen nicht mehr als einen oberflächlichen Reiz ausüben. Ihrer Aufgabe, die Trivialbedürfnisse der Leser einer gehobenen Wochenzeitung zu erfüllen, kommen sie aber vorzüglich nach. Und wenn man in den zwei Minuten, die man warten muss bis das Omelett fertig ist, belanglose Zerstreuung sucht, sind die Häppchen ideal. Man sollte nur wegen der Fettspritzer aufpassen. Denn das relativ großformatige Buch ist schön gemacht und hat überwiegend vorzügliche Porträts.
... link (0 Kommentare) ... comment
... nächste Seite