... newer stories
Donnerstag, 31. Januar 2008
Suche den Ausdruck von Liebe und Güte
Der Jugendroman Wenn er kommt, dann laufen wir von David Klass als Hörbuch
Der Jugendroman Wenn er kommt, dann laufen wir von David Klass als Hörbuch
thenoise, 20:58h
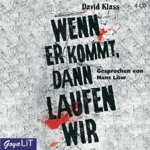 Die Gesellschaft wird schon seit Jahren infantiler. Das ist keine Kulturkritik, sondern eine Feststellung. Erwachsene, gebildete Menschen kaufen sich Alessi-Geschirr, das wie Spielzeug aussieht und lesen Harry Potter. Auch ich habe mein Bärchen-T-Shirt (was aber zumindest ironisch, wenn nicht gar als Kulturkritik aufzufassen ist). Und aus nostalgischen Gründen beschäftige ich mich noch gelegentlich mit Kinder- und Jugendmedien - und bin immer wieder ganz zufrieden dabei. Den Autorinnen und Autoren sind Grenzen gesetzt: Einen Frank Bascombe wird man unter ihren Helden nicht finden. Aber hinter dem, was als gehobene Unterhaltung für Erwachsene angeboten wird, müssen sich auch Jugendbuchautoren oft nicht verstecken. Die Geschichten von Kevin Brooks sind ziemlich kompromisslos, und auch David Klass bietet einiges. Sein Roman Wenn er kommt, dann laufen wir ist jetzt als Hörbuch erschienen.
Die Gesellschaft wird schon seit Jahren infantiler. Das ist keine Kulturkritik, sondern eine Feststellung. Erwachsene, gebildete Menschen kaufen sich Alessi-Geschirr, das wie Spielzeug aussieht und lesen Harry Potter. Auch ich habe mein Bärchen-T-Shirt (was aber zumindest ironisch, wenn nicht gar als Kulturkritik aufzufassen ist). Und aus nostalgischen Gründen beschäftige ich mich noch gelegentlich mit Kinder- und Jugendmedien - und bin immer wieder ganz zufrieden dabei. Den Autorinnen und Autoren sind Grenzen gesetzt: Einen Frank Bascombe wird man unter ihren Helden nicht finden. Aber hinter dem, was als gehobene Unterhaltung für Erwachsene angeboten wird, müssen sich auch Jugendbuchautoren oft nicht verstecken. Die Geschichten von Kevin Brooks sind ziemlich kompromisslos, und auch David Klass bietet einiges. Sein Roman Wenn er kommt, dann laufen wir ist jetzt als Hörbuch erschienen. Die Lesung des Romans wird auf vier CDs gepackt. Das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass aus dem mit mehr als 300 Seiten dicken Buch noch einiges für die Audioversion übrig bleibt.
Der Roman ist eine Liebesgeschichte und ein Krimi – aber vor allem die Geschichte einer Suche nach Recht, Moral und ethischem Verhalten.
Troy wird überraschend aus dem Gefängnis entlassen und kehrt in sein Elternhaus zurück. Für Steff, der seinen Bruder verachtet und ihn für einen unverbesserlichen Mörder hält, ist das nur schwer zu ertragen. Er leidet unter den Anfeindungen seiner Mitschüler und der Nachbarn. Steff hat feste Wertvorstellungen und gibt Troy keine Chance und erhält am Schluss noch Recht: Troy ermordet erst Steffs Klassenkameraden und verschuldet später den Herztod seines Arbeitgebers, den er beraubt. Jeff könnte seinen Bruder der Polizei auszuliefern, macht es nach einer dramatischen Begegnung doch nicht. Nachdem Troy von seinem Bruder auf dem Boot entdeckt wird, mit dem er fliehen will, hat nur einen Weg: Er muss Steff töten. Doch ausgerechnet als Steff über die Waffe hinweg in die Augen seines Bruders schaut, wird ihm bewusst, was er eigentlich schon ganze Zeit wusste: Auch Troy hat auch seine gute Seite. Das wird durch dessen Ähnlichkeit mit dem überaus friedfertigen Vater deutlich. „Versuche in seinen Augen die Augen deines Vaters zu sehen“, sagte sich Troy im Angesicht des Todes, „suche den Ausdruck von Liebe und Güte.“ Troy schiesst nicht und flieht, Steff behält das Geheimnis seiner Flucht für sich.
Der junge Schauspieler Hans Löw liest die spannende Geschichte ruhig und akzentuiert die verschiedenen Charaktere nur leicht. Er dramatisiert nicht, was von sich aus dramatisch genug ist und gibt der Geschichte und ihren Figuren keine Klangfarben, die sie nicht brauchen. Hans Löw stellt sich als Interpret nicht über die Geschichte, sondern in ihren Dienst. Das ist angenehm zu hören – und spannend bis zum Schluss.
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 27. Januar 2008
Filmtage II
thenoise, 11:40h
Wieder Filme gucken, doch ich habe den Glauben wieder gefunden.
Punk lebt - in Solothurn!
Das Filmfestival ist zwar oberflächlich gut organisiert, in wichtigen Teilen aber noch immer ein Alternativfestival. Die Preisverleihung des zum zweiten Mal vergebenen Publikumspreises unwürdig und billig. Der Gewinnerfilm war vermutlich ohnehin schlecht.
Vor dem Canva Club stehen 300 Leute, vielleicht noch mehr. Drinnen haben 80 Platz, und wahrscheinlich haben sie 40 schon vorher reingelassen. Aber niemand kommt auf die Idee, den Wartenden zu sagen, dass sie keine Chance auf Einlass haben und besser einen anderen Film suchen. Es fangen ja glücklicherweise alle gleichzeitig an, damit man nicht kurzfristig das Kino wechseln kann.
Hilflos die Moderation zu den Dokumentarfilmen am Nachmittag. Der unfähigste Moderator, den ich jemals gesehen habe und eine Frechheit den Künstlern gegenüber.
Dafür habe ich einen großartigen Fotografen wiederentdeckt, dessen Namen ich mir schon früher nach einem Magazinbeitrag merken wollte (aber das Gedächtnis ...): René Groebli. Jetzt werde ich ihn nicht mehr vergessen, was nicht an der überaus gediegenen, aber ebenso konventionellen Dokumentation liegt, sondern an Gröblis Bildern. Staunen, bewundern, beinahe erstarrt (eine Haltung, die mir nicht wirklich liegt). Ich habe einige Zeit gebraucht, um mich davon zu erholen und werde trotzdem weiter fotografieren. Aber mehr in dem Genre, dass René Gröbli nicht so liegt. Aber das geht schneller und passt eher zu Nachlässigkeit, Ungeduld und mangelnder Ausdauer - also zu mir.
Den Fotoapparat hatte ich übrigens nicht dabei. Filme abzufotografieren bringts ja nicht. Und das gesellige Stelldichein im Kreuz oder das Gedränge beim Türken, der trotz Angestelltenausfall und Filmtageandrang sowas von freundlich war - mögen zwar zu den Filmtagen gehören, aber nicht hierher.
Ach ja, richtig lustig war Radetzky in China, eine Doku von Heidi Hiltebrand über die Tournee des Symphonischen Orchesters Zürich durch China. Die Regisseurin hatte sicherlich weniger Geld als der kulturverbissene Gröbli-Dokumentarist Phil Dänzer und chaotischere Arbeitsbedingungen. Aber vermutlich nicht nur eine andere Art, sondern auch mehr Spaß und weniger über Geldmangel gejammert.
Die Filmtage braucht man eher, um Freunde zu treffen. Denn unterm Strich schaut man sich zu viele durchschnittliche und schlechte Filme an (von denen so viele vom Staatsfernsehen koproduziert wurden, dass man die meisten beim Festival gezeigten - hätte man einen Fernseher - auch auf einem seiner Kanäle sehen könnte). Aber immerhin, so erfolglos wie der erste Besuch war der zweite nicht.
Und jetzt gibt's Frühstück.
Punk lebt - in Solothurn!
Das Filmfestival ist zwar oberflächlich gut organisiert, in wichtigen Teilen aber noch immer ein Alternativfestival. Die Preisverleihung des zum zweiten Mal vergebenen Publikumspreises unwürdig und billig. Der Gewinnerfilm war vermutlich ohnehin schlecht.
Vor dem Canva Club stehen 300 Leute, vielleicht noch mehr. Drinnen haben 80 Platz, und wahrscheinlich haben sie 40 schon vorher reingelassen. Aber niemand kommt auf die Idee, den Wartenden zu sagen, dass sie keine Chance auf Einlass haben und besser einen anderen Film suchen. Es fangen ja glücklicherweise alle gleichzeitig an, damit man nicht kurzfristig das Kino wechseln kann.
Hilflos die Moderation zu den Dokumentarfilmen am Nachmittag. Der unfähigste Moderator, den ich jemals gesehen habe und eine Frechheit den Künstlern gegenüber.
Dafür habe ich einen großartigen Fotografen wiederentdeckt, dessen Namen ich mir schon früher nach einem Magazinbeitrag merken wollte (aber das Gedächtnis ...): René Groebli. Jetzt werde ich ihn nicht mehr vergessen, was nicht an der überaus gediegenen, aber ebenso konventionellen Dokumentation liegt, sondern an Gröblis Bildern. Staunen, bewundern, beinahe erstarrt (eine Haltung, die mir nicht wirklich liegt). Ich habe einige Zeit gebraucht, um mich davon zu erholen und werde trotzdem weiter fotografieren. Aber mehr in dem Genre, dass René Gröbli nicht so liegt. Aber das geht schneller und passt eher zu Nachlässigkeit, Ungeduld und mangelnder Ausdauer - also zu mir.
Den Fotoapparat hatte ich übrigens nicht dabei. Filme abzufotografieren bringts ja nicht. Und das gesellige Stelldichein im Kreuz oder das Gedränge beim Türken, der trotz Angestelltenausfall und Filmtageandrang sowas von freundlich war - mögen zwar zu den Filmtagen gehören, aber nicht hierher.
Ach ja, richtig lustig war Radetzky in China, eine Doku von Heidi Hiltebrand über die Tournee des Symphonischen Orchesters Zürich durch China. Die Regisseurin hatte sicherlich weniger Geld als der kulturverbissene Gröbli-Dokumentarist Phil Dänzer und chaotischere Arbeitsbedingungen. Aber vermutlich nicht nur eine andere Art, sondern auch mehr Spaß und weniger über Geldmangel gejammert.
Die Filmtage braucht man eher, um Freunde zu treffen. Denn unterm Strich schaut man sich zu viele durchschnittliche und schlechte Filme an (von denen so viele vom Staatsfernsehen koproduziert wurden, dass man die meisten beim Festival gezeigten - hätte man einen Fernseher - auch auf einem seiner Kanäle sehen könnte). Aber immerhin, so erfolglos wie der erste Besuch war der zweite nicht.
Und jetzt gibt's Frühstück.
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 26. Januar 2008
Filmtage
thenoise, 13:18h
Gestern zum ersten Mal bei den Solothurner Filmtagen. Keine besondere Atmosphäre. Nur viele Leute, von denen einige ihre Freude über schale Gags nicht anders als der durchschnittliche Multiplex-Kino-Besucher ausdrücken.
Die wirklich überraschende Erkenntnis nach einer langen Kinonacht und gefühlten 15 Lang- und Kurzfilmen: Klopperfilme sind sowohl handwerklich als auch auf die Handlung bezogen den anderen Genres weit voraus.
Muss ich in Zukunft doch ins Hollywoodkino?
Die wirklich überraschende Erkenntnis nach einer langen Kinonacht und gefühlten 15 Lang- und Kurzfilmen: Klopperfilme sind sowohl handwerklich als auch auf die Handlung bezogen den anderen Genres weit voraus.
Muss ich in Zukunft doch ins Hollywoodkino?
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 24. Januar 2008
Liars – Liars
thenoise, 09:09h
Normalerweise höre ich ja lieber das Original und nicht die Epigonen. Doch What Would They Know von den Liars macht mir noch mehr Lust darauf, Control zu sehen.
... link (0 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 23. Januar 2008
Jahrmarkt im Museum
Es klackert, brummt und kleckst in der Schirn
Es klackert, brummt und kleckst in der Schirn
thenoise, 13:16h
Die Frage, was Kunst ist und welche Merkmale ein Werk haben muss, um berechtigt als Kunstwerk bezeichnet zu werden, treibt die Kulturdenker schon lange um. Es ist eine Frage der Zeit. Und natürlich eine der Kreativität. Oder eine der (kollektiven) Vergesslichkeit. Dass man in der durchaus vergnüglichen und anregenden Ausstellung Kunstmaschinen Maschinenkunst eine Antwort darauf bekommt, wie ich es mitunter in Ausstellungsbesprechungen las, stimmt nicht und muss auch nicht sein.
Kunst muss ohnehin keine Fragen stellen und keine Antworten geben. Kunst muss gar nichts, eine Ausstellung fast nichts. Sie sollte anregen, vielleicht auch nur unterhalten. Kunstmaschinen Maschinenkunst macht beides.

So einfach wie anregend: Adam - Pawel Althamers
Plastik, ganz aus Plastik.
So habe ich mich ausreichend an einem Maschinchen vergnügt, mit dem sich Damien Hirst selbst entzaubert. Nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten: Denn seine Zeichenmaschine ist nichts anderes als eine Jahrmarktstradition längst vergangener Tage. Neben den aktuellen schrillen Rummelplatzmaschinen könnte man mit ihr keinen Staat machen. Allenfalls zum Oktoberfest würde sie noch passen, zwischen dem handbetriebenem Ringelspiel und dem Flohzirkus. Aber erst der Standort Museum macht die mit dieser Maschine gefertigten bunten Blätter zu Kunstwerken.

Der Name ist nicht zwangsläufig Programm: Making
Beautiful Drawings von Damien Hirst.
Die auf den ersten Blick nur putzig anzusehende Plastikflasche aus Pawel Althamers Extrusion Machine ist da schon viel weniger oberflächlich als es scheint. Die Falsche in Figurenform heißt Adam und zeigt einen nackten, durchschnittlich aussehenden älteren Menschen mit einer blauen Kappe als Verschluss. Das ist mehr als putzig. Denn die Kunststoffspritzstoffmaschine wurde von Pawel Althamers Vater erfunden. Der Sohn hat sie zweckentfremdet. Er stellt damit nicht profane Flaschen her, sondern Plastiken, die seinen nackten Vater, Adam Althamer, zeigen – und schon ist ein weiterer Bezug da, einer zu Menschheitsgeschichte und Autorschaft.
Das Nebeneinander von Mechanik (in den Maschinen von Jean Tinguely, Tim Lewis und Rebecca Horn etwa) und internetbasierten Werken wie Miltos Manetas’ Jackson-Pollock-Klecksprogramm, von Oberflächlichem und Hintersinnigem ist unterhaltsam und anregend. Und das äußerst reduzierte Werk aus zerrinnenden Klecksen, das ich mit Hirsts Jahrmarktsmaschine gemacht habe, erfreut mich – billige Idee hin oder her – immer wieder. Jetzt brauche ich nur noch ein Exemplar des unverkäuflichen Adam. Aber vielleicht würden den meine Dogon-Heiligen gar nicht in ihre Gemeinschaft integrieren wollen?
Kunstmaschinen Maschinenkunst, Schirn, 10.10.2007 - 27.1.2008
Kunst muss ohnehin keine Fragen stellen und keine Antworten geben. Kunst muss gar nichts, eine Ausstellung fast nichts. Sie sollte anregen, vielleicht auch nur unterhalten. Kunstmaschinen Maschinenkunst macht beides.

So einfach wie anregend: Adam - Pawel Althamers
Plastik, ganz aus Plastik.
So habe ich mich ausreichend an einem Maschinchen vergnügt, mit dem sich Damien Hirst selbst entzaubert. Nicht auf den ersten Blick, aber auf den zweiten: Denn seine Zeichenmaschine ist nichts anderes als eine Jahrmarktstradition längst vergangener Tage. Neben den aktuellen schrillen Rummelplatzmaschinen könnte man mit ihr keinen Staat machen. Allenfalls zum Oktoberfest würde sie noch passen, zwischen dem handbetriebenem Ringelspiel und dem Flohzirkus. Aber erst der Standort Museum macht die mit dieser Maschine gefertigten bunten Blätter zu Kunstwerken.

Der Name ist nicht zwangsläufig Programm: Making
Beautiful Drawings von Damien Hirst.
Die auf den ersten Blick nur putzig anzusehende Plastikflasche aus Pawel Althamers Extrusion Machine ist da schon viel weniger oberflächlich als es scheint. Die Falsche in Figurenform heißt Adam und zeigt einen nackten, durchschnittlich aussehenden älteren Menschen mit einer blauen Kappe als Verschluss. Das ist mehr als putzig. Denn die Kunststoffspritzstoffmaschine wurde von Pawel Althamers Vater erfunden. Der Sohn hat sie zweckentfremdet. Er stellt damit nicht profane Flaschen her, sondern Plastiken, die seinen nackten Vater, Adam Althamer, zeigen – und schon ist ein weiterer Bezug da, einer zu Menschheitsgeschichte und Autorschaft.
Das Nebeneinander von Mechanik (in den Maschinen von Jean Tinguely, Tim Lewis und Rebecca Horn etwa) und internetbasierten Werken wie Miltos Manetas’ Jackson-Pollock-Klecksprogramm, von Oberflächlichem und Hintersinnigem ist unterhaltsam und anregend. Und das äußerst reduzierte Werk aus zerrinnenden Klecksen, das ich mit Hirsts Jahrmarktsmaschine gemacht habe, erfreut mich – billige Idee hin oder her – immer wieder. Jetzt brauche ich nur noch ein Exemplar des unverkäuflichen Adam. Aber vielleicht würden den meine Dogon-Heiligen gar nicht in ihre Gemeinschaft integrieren wollen?
Kunstmaschinen Maschinenkunst, Schirn, 10.10.2007 - 27.1.2008
... link (0 Kommentare) ... comment
... older stories