... newer stories
Montag, 28. März 2011
Nachschlag
Christy & Emily im TiK in Dornbirn
Christy & Emily im TiK in Dornbirn
thenoise, 22:38h
Das Duo aus Brooklyn hat seine musikalische Heimat in Süddeutschland gefunden. Dadurch sind sie in unseren Breitengraden vermutlich öfter zu hören als zu Hause. Wenige Monate nach ihrer letzten Tour haben sie wieder ein paar neue Lieder vorbeigebracht.

Vor überschaubarem Publikum: Emily Manzo (l.) und Christy Edwards
Es gibt Musik, die funktioniert in der Fremde besser als zu Hause. Calvin Russels Roots-Rock beispielsweise kommt in Europa besser an als in den USA. Christy Edwards und Emily Manzo wiederum haben ihre musikalische Heimat beim deutschen Indie-Label Klangbad gefunden. Ende vergangenen Jahres waren sie im deutschsprachigen Raum unterwegs. Jetzt gibt es mit einer neu erschienenen EP im Gepäck noch einen Nachschlag – in Dornbirn vor einem zwar überschaubaren, aber dankbaren und wohlgesinnten Publikum.
Mit ihren Stücken reihen sich Christy & Emily in das unübersehbare Feld der Musiker ein, deren Bandbreite vom Folksong bis zum eruptiven Ausbruch reicht. Im Konzert präsentierten sie – wohl auch, weil so manche gewollte Zwischentöne auf der Strecke blieben – zunehmend ihre energischere Seite. Bass und Schlagzeug legten dafür ein solides Fundament, und Christy Edwards warf gelegentlich wohltemperierte, schlichte Solo-Passagen ein. Freiräume, welche die beiden Mitmusiker nicht bekamen. Zumindest die Schlagzeugerin hätte sie wohl ohnehin kaum sinnvoll füllen können. So steigerte sich das Konzert langsam bis zum letzten gemeinsamen Ausbruch. Wer sich nicht eindringlich leise einprägen möchte, sorgt für Lärm und Energie. Das kommt immer wieder gut an. Für die von einer grösseren und agileren Konkurrenz umlagerten Heimatbühnen scheint das noch nicht ganz zu reichen. Immerhin, das beweisen Christy & Emily, das Fundament ist gelegt. Wie sehr es trägt, wird man noch sehen.
Nächste Konzerte: 8.4. Fürth, 9.4. Stuttgart

Vor überschaubarem Publikum: Emily Manzo (l.) und Christy Edwards
Es gibt Musik, die funktioniert in der Fremde besser als zu Hause. Calvin Russels Roots-Rock beispielsweise kommt in Europa besser an als in den USA. Christy Edwards und Emily Manzo wiederum haben ihre musikalische Heimat beim deutschen Indie-Label Klangbad gefunden. Ende vergangenen Jahres waren sie im deutschsprachigen Raum unterwegs. Jetzt gibt es mit einer neu erschienenen EP im Gepäck noch einen Nachschlag – in Dornbirn vor einem zwar überschaubaren, aber dankbaren und wohlgesinnten Publikum.
Mit ihren Stücken reihen sich Christy & Emily in das unübersehbare Feld der Musiker ein, deren Bandbreite vom Folksong bis zum eruptiven Ausbruch reicht. Im Konzert präsentierten sie – wohl auch, weil so manche gewollte Zwischentöne auf der Strecke blieben – zunehmend ihre energischere Seite. Bass und Schlagzeug legten dafür ein solides Fundament, und Christy Edwards warf gelegentlich wohltemperierte, schlichte Solo-Passagen ein. Freiräume, welche die beiden Mitmusiker nicht bekamen. Zumindest die Schlagzeugerin hätte sie wohl ohnehin kaum sinnvoll füllen können. So steigerte sich das Konzert langsam bis zum letzten gemeinsamen Ausbruch. Wer sich nicht eindringlich leise einprägen möchte, sorgt für Lärm und Energie. Das kommt immer wieder gut an. Für die von einer grösseren und agileren Konkurrenz umlagerten Heimatbühnen scheint das noch nicht ganz zu reichen. Immerhin, das beweisen Christy & Emily, das Fundament ist gelegt. Wie sehr es trägt, wird man noch sehen.
Nächste Konzerte: 8.4. Fürth, 9.4. Stuttgart
... link (0 Kommentare) ... comment
Sonntag, 20. März 2011
M. Walking On The Water – Flowers For The Departed
thenoise, 13:05h
 M. Walking On The Water landete als respektable deutsche Indie-Band einige Jahre nach der Gründung bei einem Major-Label und schaffte es sogar auf die hinteren Rängen der Charts. Nach sieben Alben in zwölf Jahren beendete die Band ihre Arbeit - vorübergehend, wie sich Anfang dieses Jahres herausstellte. Denn vor kurzem ist nach vierzehnjähriger Pause das neue Album "Flowers For The Departed" erschienen.
M. Walking On The Water landete als respektable deutsche Indie-Band einige Jahre nach der Gründung bei einem Major-Label und schaffte es sogar auf die hinteren Rängen der Charts. Nach sieben Alben in zwölf Jahren beendete die Band ihre Arbeit - vorübergehend, wie sich Anfang dieses Jahres herausstellte. Denn vor kurzem ist nach vierzehnjähriger Pause das neue Album "Flowers For The Departed" erschienen. Die Krefelder Gruppe hat zweifellos ein Talent für eingängige Melodien, und sie richten diese gerne üppig an. Es gibt Tempiwechsel, mal ein Stück im Zweivierteltakt und immer wieder nette Akzente. Das alles macht jedoch «Flowers Of The Departed» zu nicht mehr als einem soliden Album. Zwar gibt es Höhepunkte wie «Questionmark» mit seinem heftigen Auftakt oder den Rumba-Rhythmus von «Twist Your Head». Aber schon letzterem mangelt es auf Dauer an Intensität. Gut vorstellbar, dass sich diese bei den Konzerten noch steigert.
Trotzdem: Wirklich herausragende Stücke bringt die Band nicht, es überwiegen die durchschnittlich-öden Stücke «Heavenlove», «Song For The Nameless» oder «Lucky Girl». Selbst die überzeugenderen machen nicht wunschlos glücklich. Bei «Dust In The Suitcase» etwa wünscht man sich die Bissigkeit eines Philip Boa, das durch einen Kinderchor angenehm aufgehübschte, aber ebenfalls wie von Boa abgekupferte «Questionmark» bremst völlig unnötig ein zwanghaft wirkendes Break.
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 5. März 2011
Warum tanzt denn hier keiner?
Die Aeronauten spielen trotzdem schwungvoll und mitreißend
Die Aeronauten spielen trotzdem schwungvoll und mitreißend
thenoise, 21:48h
Vor 25 Jahren schon sei er im Fabriggli aufgetreten, erzählt Frontmann Oliver Maurmann, damals noch mit seinem Trio Freds Freunde. Dann lassen es die Aeronauten noch einmal krachen. Es ist bereits das zweite Zugabenset des Abends, sie spielen direkter, punkiger als zuvor und signalisieren damit: Diese Erinnerung an die Anfänge ist der Schlusspunkt eines Best-Of-Programms mit frühen, nach wie vor unverwünstlichen Stücken wie «Sexy Terrorist» und «Freundin» und aktuellen wie «Hallo Leidenschaft» und «Womunidure».

Teilen sich das Mikrofon: Oliver Mauermann und Roger Greipl (v.l.).
Die Aeronauten wollten zu ihren oft hintersinnig-ironischen Texten immer schon fetzig- geschmeidige Musik ohne stilistische Grenzen machen. Soulige Bläser gehören zum Standard, Anleihen an Ska und Country sind eine willkommene Abwechslung. Mittlerweile hat das Können den Willen zur Stilvielfalt annähernd eingeholt. Sie haben alle positiven Qualitäten einer Partyband: sie sind stilistisch abwechslungsreich, sie sind schmissig und sie verbreiten gute Laune. Weil sie aber nicht irgendwelche Gassenhauer nachspielen, sondern in ihren Texten eigenwillige Geschichten mit oft passend schräg phrasierten Reimen erzählen, spielen sie nur vor ein paar versprengten Fans.

Klein beim moderieren, groß bei Grimassen: Matthias Hipp am Bass.
Die Aeronauten starten ausgelassen und voller Bewegungsdrang – ganz so, als ob man sie schon lange nicht mehr auf die Bühne gelassen hätte. So sehen Menschen aus, die Spaß an der Arbeit haben. Matthias Hipp gibt den Faxenmacher (was immer dann in die Hosen geht, wenn er die Ansagen übernimmt), Samuel Hartmann den beseelten Gitarristen, und Oliver Mauermann übernimmt wie gewohnt die Rolle des Anti-Conférenciers. Er gibt dem Auftritt den Charme des Unperfekten. Eine durchgestylte Aeronauten-Show wäre ohnehin nicht glaubwürdig und würde wohl die Reputation untergraben.

Inbrünstig und schmissig: Trompeter Roman Bergamin.
Die Aeronauten haben vornehmlich treibende Stücke ausgesucht. Zwischendurch nehmen sie ein bisschen Tempo raus. Und wenn sie mal unfreiwillig ein wenig an Fahrt verlieren, fangen sie sich rasch wieder. Es findet sich immer mehr als einer, der antreibt und mitreißt. Dass keiner tanzt, liegt nicht an den Aeronauten, sondern am Publikum. «Es sind viel mehr Männer hier als Frauen», stellte Oliver Mauermann schon nach wenigen Stücken fest, «wird brauchen also nicht damit zu rechnen, dass heute Abend getanzt wird. Die Aeronauten haben trotzdem vorschriftsmäßig abgehoben.

Teilen sich das Mikrofon: Oliver Mauermann und Roger Greipl (v.l.).
Die Aeronauten wollten zu ihren oft hintersinnig-ironischen Texten immer schon fetzig- geschmeidige Musik ohne stilistische Grenzen machen. Soulige Bläser gehören zum Standard, Anleihen an Ska und Country sind eine willkommene Abwechslung. Mittlerweile hat das Können den Willen zur Stilvielfalt annähernd eingeholt. Sie haben alle positiven Qualitäten einer Partyband: sie sind stilistisch abwechslungsreich, sie sind schmissig und sie verbreiten gute Laune. Weil sie aber nicht irgendwelche Gassenhauer nachspielen, sondern in ihren Texten eigenwillige Geschichten mit oft passend schräg phrasierten Reimen erzählen, spielen sie nur vor ein paar versprengten Fans.

Klein beim moderieren, groß bei Grimassen: Matthias Hipp am Bass.
Die Aeronauten starten ausgelassen und voller Bewegungsdrang – ganz so, als ob man sie schon lange nicht mehr auf die Bühne gelassen hätte. So sehen Menschen aus, die Spaß an der Arbeit haben. Matthias Hipp gibt den Faxenmacher (was immer dann in die Hosen geht, wenn er die Ansagen übernimmt), Samuel Hartmann den beseelten Gitarristen, und Oliver Mauermann übernimmt wie gewohnt die Rolle des Anti-Conférenciers. Er gibt dem Auftritt den Charme des Unperfekten. Eine durchgestylte Aeronauten-Show wäre ohnehin nicht glaubwürdig und würde wohl die Reputation untergraben.

Inbrünstig und schmissig: Trompeter Roman Bergamin.
Die Aeronauten haben vornehmlich treibende Stücke ausgesucht. Zwischendurch nehmen sie ein bisschen Tempo raus. Und wenn sie mal unfreiwillig ein wenig an Fahrt verlieren, fangen sie sich rasch wieder. Es findet sich immer mehr als einer, der antreibt und mitreißt. Dass keiner tanzt, liegt nicht an den Aeronauten, sondern am Publikum. «Es sind viel mehr Männer hier als Frauen», stellte Oliver Mauermann schon nach wenigen Stücken fest, «wird brauchen also nicht damit zu rechnen, dass heute Abend getanzt wird. Die Aeronauten haben trotzdem vorschriftsmäßig abgehoben.
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 26. Februar 2011
Ende gut, fast alles gut
Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba im Moods
Bassekou Kouyaté & Ngoni Ba im Moods
thenoise, 13:01h
Eine gute Idee ist schon die halbe Miete: Dass Bassekou Kouyatés Gruppe mit vier in unterschiedlichen Lagen spielenden Ngonis besetzt ist, sorgt für ein Alleinstellungsmerkmal. Zusätzlich wurde das Instrument weiterentwickelt. Während die traditionelle Ngoni drei- oder viersaitig ist, haben sie die malischen Musiker auf bis zu sieben Seiten erweitert. Die Saiten sind anstelle von Holz- mit Metallwirbel aufgezogen, ein Tonabnehmer ist selbstverständlich. Bassekou Kouyaté setzt auch Effektgeräte ein - auffällig dabei das Wah-Wah, was ihm den Beinahmen «Hendrix aus Mali» eingebracht hat.
 Den gesamten Auftritt über dominiert ausgelassene Fröhlichkeit, die aber Anfangs nicht recht echt wirken mag. Dabei würde sie der Gruppe gut anstehen. Sie spielt spritzig und virtuos, formiert sich immer wieder zu kleinen Tanzeinlagen und hat mit Kouyatés Frau Amy Sacko eine stimmgewaltige Sängerin. Nachdem sich Kouyaté im ersten Teil des Konzerts noch etwas schwer tut, den Übergang von tanzbaren zu lyrischen Stücken zu gestalten, schafft er das nach der Pause scheinbar mühelos. Da stört es auch kaum, dass manche Einsätze – etwa die Talking-Drum-Einlagen des Perkussionisten Moussa Sissoko – vor allem effektheischend sind.
Den gesamten Auftritt über dominiert ausgelassene Fröhlichkeit, die aber Anfangs nicht recht echt wirken mag. Dabei würde sie der Gruppe gut anstehen. Sie spielt spritzig und virtuos, formiert sich immer wieder zu kleinen Tanzeinlagen und hat mit Kouyatés Frau Amy Sacko eine stimmgewaltige Sängerin. Nachdem sich Kouyaté im ersten Teil des Konzerts noch etwas schwer tut, den Übergang von tanzbaren zu lyrischen Stücken zu gestalten, schafft er das nach der Pause scheinbar mühelos. Da stört es auch kaum, dass manche Einsätze – etwa die Talking-Drum-Einlagen des Perkussionisten Moussa Sissoko – vor allem effektheischend sind.
 Dafür ist die Verbindung, die Bassekou Kouyaté zwischen traditioneller und westlicher Musik schafft, harmonisch und interessant. Zum Teil ist sie ohnehin schon in der traditionellen Musik angelegt. Denn aus den traditionellen mit der Ngoni gespielten Liedern der Bambara, oft Sprechgesänge, finden sich schon Elemente des Blues. Wenn dann nach einem längeren, urtümlich wirkenden Intro von Bassekou Kouyaté der Bass-Ngoni-Spieler mit einem Blues-Akzent einfällt, ist die Synthese schon perfekt. Dazu gibt es immer wieder Stücke, die traditionellen Chorgesang zitieren (auch wenn es kein Frauenchor ist, sondern drei Sänger für die mehrstimmigen Parts sorgen), wie ihn die westlichen Hörer beispielsweise auch bei anderen malischen Musikern, etwa Oumou Sangaré, schätzen.
Dafür ist die Verbindung, die Bassekou Kouyaté zwischen traditioneller und westlicher Musik schafft, harmonisch und interessant. Zum Teil ist sie ohnehin schon in der traditionellen Musik angelegt. Denn aus den traditionellen mit der Ngoni gespielten Liedern der Bambara, oft Sprechgesänge, finden sich schon Elemente des Blues. Wenn dann nach einem längeren, urtümlich wirkenden Intro von Bassekou Kouyaté der Bass-Ngoni-Spieler mit einem Blues-Akzent einfällt, ist die Synthese schon perfekt. Dazu gibt es immer wieder Stücke, die traditionellen Chorgesang zitieren (auch wenn es kein Frauenchor ist, sondern drei Sänger für die mehrstimmigen Parts sorgen), wie ihn die westlichen Hörer beispielsweise auch bei anderen malischen Musikern, etwa Oumou Sangaré, schätzen.
 Vielleicht war die Aufwärmphase zum Tourauftakt der Grund dafür, dass sich die überwiegend guten Solitäre der ersten Konzerthälfte nicht zu einem harmonischen Ganzen fügten. Nach der Pause waren die Probleme überwunden: Die Tänzchen wurden lebendiger und das Trennende zwischen den Stücken verschwand - Ende gut, fast alles gut.
Vielleicht war die Aufwärmphase zum Tourauftakt der Grund dafür, dass sich die überwiegend guten Solitäre der ersten Konzerthälfte nicht zu einem harmonischen Ganzen fügten. Nach der Pause waren die Probleme überwunden: Die Tänzchen wurden lebendiger und das Trennende zwischen den Stücken verschwand - Ende gut, fast alles gut.
Konzerte: 26.2., München, 27.2.2011, Rubigen (CH), 28.2. Freiburg, 1.3. Erlangen, 2.3., Innsbruck
 Den gesamten Auftritt über dominiert ausgelassene Fröhlichkeit, die aber Anfangs nicht recht echt wirken mag. Dabei würde sie der Gruppe gut anstehen. Sie spielt spritzig und virtuos, formiert sich immer wieder zu kleinen Tanzeinlagen und hat mit Kouyatés Frau Amy Sacko eine stimmgewaltige Sängerin. Nachdem sich Kouyaté im ersten Teil des Konzerts noch etwas schwer tut, den Übergang von tanzbaren zu lyrischen Stücken zu gestalten, schafft er das nach der Pause scheinbar mühelos. Da stört es auch kaum, dass manche Einsätze – etwa die Talking-Drum-Einlagen des Perkussionisten Moussa Sissoko – vor allem effektheischend sind.
Den gesamten Auftritt über dominiert ausgelassene Fröhlichkeit, die aber Anfangs nicht recht echt wirken mag. Dabei würde sie der Gruppe gut anstehen. Sie spielt spritzig und virtuos, formiert sich immer wieder zu kleinen Tanzeinlagen und hat mit Kouyatés Frau Amy Sacko eine stimmgewaltige Sängerin. Nachdem sich Kouyaté im ersten Teil des Konzerts noch etwas schwer tut, den Übergang von tanzbaren zu lyrischen Stücken zu gestalten, schafft er das nach der Pause scheinbar mühelos. Da stört es auch kaum, dass manche Einsätze – etwa die Talking-Drum-Einlagen des Perkussionisten Moussa Sissoko – vor allem effektheischend sind. Dafür ist die Verbindung, die Bassekou Kouyaté zwischen traditioneller und westlicher Musik schafft, harmonisch und interessant. Zum Teil ist sie ohnehin schon in der traditionellen Musik angelegt. Denn aus den traditionellen mit der Ngoni gespielten Liedern der Bambara, oft Sprechgesänge, finden sich schon Elemente des Blues. Wenn dann nach einem längeren, urtümlich wirkenden Intro von Bassekou Kouyaté der Bass-Ngoni-Spieler mit einem Blues-Akzent einfällt, ist die Synthese schon perfekt. Dazu gibt es immer wieder Stücke, die traditionellen Chorgesang zitieren (auch wenn es kein Frauenchor ist, sondern drei Sänger für die mehrstimmigen Parts sorgen), wie ihn die westlichen Hörer beispielsweise auch bei anderen malischen Musikern, etwa Oumou Sangaré, schätzen.
Dafür ist die Verbindung, die Bassekou Kouyaté zwischen traditioneller und westlicher Musik schafft, harmonisch und interessant. Zum Teil ist sie ohnehin schon in der traditionellen Musik angelegt. Denn aus den traditionellen mit der Ngoni gespielten Liedern der Bambara, oft Sprechgesänge, finden sich schon Elemente des Blues. Wenn dann nach einem längeren, urtümlich wirkenden Intro von Bassekou Kouyaté der Bass-Ngoni-Spieler mit einem Blues-Akzent einfällt, ist die Synthese schon perfekt. Dazu gibt es immer wieder Stücke, die traditionellen Chorgesang zitieren (auch wenn es kein Frauenchor ist, sondern drei Sänger für die mehrstimmigen Parts sorgen), wie ihn die westlichen Hörer beispielsweise auch bei anderen malischen Musikern, etwa Oumou Sangaré, schätzen. Vielleicht war die Aufwärmphase zum Tourauftakt der Grund dafür, dass sich die überwiegend guten Solitäre der ersten Konzerthälfte nicht zu einem harmonischen Ganzen fügten. Nach der Pause waren die Probleme überwunden: Die Tänzchen wurden lebendiger und das Trennende zwischen den Stücken verschwand - Ende gut, fast alles gut.
Vielleicht war die Aufwärmphase zum Tourauftakt der Grund dafür, dass sich die überwiegend guten Solitäre der ersten Konzerthälfte nicht zu einem harmonischen Ganzen fügten. Nach der Pause waren die Probleme überwunden: Die Tänzchen wurden lebendiger und das Trennende zwischen den Stücken verschwand - Ende gut, fast alles gut.Konzerte: 26.2., München, 27.2.2011, Rubigen (CH), 28.2. Freiburg, 1.3. Erlangen, 2.3., Innsbruck
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 25. Februar 2011
Nüchtern und energiegeladen
Wire im Abart, Zürich (CH)
Wire im Abart, Zürich (CH)
thenoise, 20:50h
Ihre Grösse ist unbestritten, richtig gross waren sie nie: Wire agierten immer in einer Nische. Sie haben den Punk schon so früh in Wave transformiert, dass man sie gar nicht mehr mit dem frühen, lärmigen Sound in Verbindung bringt. Sie hatten bald aufgehört, es überwiegend krachen zu lassen. Beibehalten haben sie, dass manche ihrer Songs nicht nur kurz sind, sondern mit einem abrupten Schnitt enden, beinahe schmerzhaft.

Colin Wilson: außen britische Biederkeit, innen punkige Energie
Wire kennen keine Attitüde, keine Eitelkeiten, keine Anbiederung – eine kurze scherzhafte Bemerkung zum Auftakt und dann nur noch Musik aus 30 Jahren. «106 Beats That» vom Debütalbum «Pink Flag» ist ebenso dabei wie spätere, etwa „Advantage In Height“ aus dem 1987er Album «The Ideal Copy», und Stücke aus dem aktuellen Album «Red Barked Tree», etwa «Moreover» und der als solcher nicht unbedingt kenntlich gemachte Ohrwurm «Please Take».

Graham Lewis: starke Mütze am Bass
Wire spielen ihr Set nicht ganz so trocken wie auf dem Album, sind aber durchweg nüchtern und direkt. Wire spielen kein fulminantes Konzert, beeindrucken aber besonders bei den kraftvollen Stücken. Hier fällt weniger auf, dass sie nicht stimmgewaltig sind. Der mehr sprechsingende Colin Wilson hat damit weniger Probleme als Graham Lewis, der das – zumindest was die Melodie betrifft – durchaus poppige «Please Take» geschrieben hat. Das Konzept der wieder einmal zum Trio geschrumpften Gruppe funktioniert nach wie vor. Massgeblichen Anteil daran hat der noch junge Gastgitarrist Matt Simms, der auf der Bühne den 2008 ausgestiegenen Bruce Gilbert ersetzt und nicht nur hervorragend lärmt, sondern auch kreischend-subtile Akzente setzt.
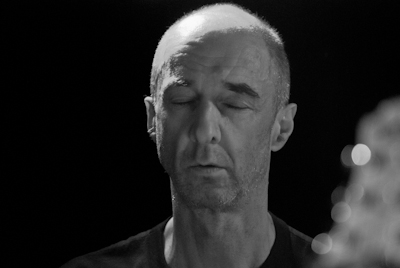
Richard Grey: trommelt wie vor dreißig Jahren
Nächste Konzerte: 25.2. München, 26.2. Berlin, 28.2. Köln, 1.3. Hamburg

Colin Wilson: außen britische Biederkeit, innen punkige Energie
Wire kennen keine Attitüde, keine Eitelkeiten, keine Anbiederung – eine kurze scherzhafte Bemerkung zum Auftakt und dann nur noch Musik aus 30 Jahren. «106 Beats That» vom Debütalbum «Pink Flag» ist ebenso dabei wie spätere, etwa „Advantage In Height“ aus dem 1987er Album «The Ideal Copy», und Stücke aus dem aktuellen Album «Red Barked Tree», etwa «Moreover» und der als solcher nicht unbedingt kenntlich gemachte Ohrwurm «Please Take».

Graham Lewis: starke Mütze am Bass
Wire spielen ihr Set nicht ganz so trocken wie auf dem Album, sind aber durchweg nüchtern und direkt. Wire spielen kein fulminantes Konzert, beeindrucken aber besonders bei den kraftvollen Stücken. Hier fällt weniger auf, dass sie nicht stimmgewaltig sind. Der mehr sprechsingende Colin Wilson hat damit weniger Probleme als Graham Lewis, der das – zumindest was die Melodie betrifft – durchaus poppige «Please Take» geschrieben hat. Das Konzept der wieder einmal zum Trio geschrumpften Gruppe funktioniert nach wie vor. Massgeblichen Anteil daran hat der noch junge Gastgitarrist Matt Simms, der auf der Bühne den 2008 ausgestiegenen Bruce Gilbert ersetzt und nicht nur hervorragend lärmt, sondern auch kreischend-subtile Akzente setzt.
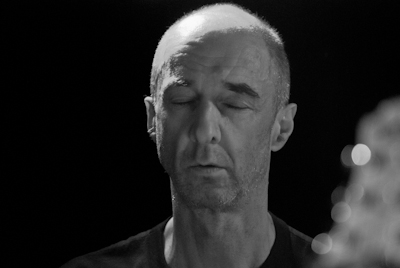
Richard Grey: trommelt wie vor dreißig Jahren
Nächste Konzerte: 25.2. München, 26.2. Berlin, 28.2. Köln, 1.3. Hamburg
... link (0 Kommentare) ... comment
... older stories