... newer stories
Samstag, 6. Dezember 2008
Zeichnen mit Sprengstoff
Filme und Videos von Roman Signer im Helmhaus Zürich
Filme und Videos von Roman Signer im Helmhaus Zürich
thenoise, 16:00h
Er ist der Pyromane unter den bildenden Künstlern. Aber anders als die feuerliebenden Rammstein - deren durchaus beeindruckende Pyrotechnik nicht mehr als feurig-albern ist - sind Roman Signers Arbeiten hintersinnig, verschmitzt und mitunter ungemein poetisch. Etwa wenn er in seiner Installation Sandmusik über eine Geige bloss Sand rieseln lässt und so die Saiten zum Klingen bringt, oder wenn er vor einen Durchgang einen Sandvorhang installiert.
Lautmalerischer sind seine Videos, in denen er Modellhubschrauber einsetzt - mal wie ein einzelnes Insekt in einer Kiste, dann wieder mehr als 50, die er gleichzeitig in einem Raum fliegen lässt. Auch sie schwirren wie gefangene Insekten umher, bringen sich gegenseitig zum Absturz, fliegen - wie hilflose Vögel gegen Glasfenster schmettern - gegen die Wand und kreiseln auf dem Boden im Todeskampf.

Ungleiches Wettrennen am Binnenkanal im Rheintal:
Kajak 2000, Videostill: Aleksandra Signer
Richtig laut wird es, wenn Signer seine Kindheitsträume auslebt, einen Regenschirm mit Sprengstoff raketengleich in die Decke schießt, mit einer Rakete um die Wette läuft, oder einen mit Wasserfässern beladenen Piaggio-Transporter durch eine riesige Halfpipe schickt.
Roman Signer hat, wie er selbst sagt, auch als Erwachsener einfach weitergespielt. Das macht er ziellos und zweckfrei. Die Ausstellung zeigt Filme und Videos von 1975 bis heute. Sie machen Spass, leben von der Lust der Zerstörung oder einfach von «blöden» Ideen. Signer schiesst mit Sprengstoff einen Hocker vom Schornstein einer Papierfabrik in hohem Bogen durch die Luft, lässt sich in einem Kajak den Rheindamm entlangziehen, bis es durchgescheuert und voller Kies ist, er setzt Sprengstoff als Zeichenimpuls ein und verstopft den Durchfluss unter der Brücke eines Bächleins mit einem Gummiball - bis dieser vom Wasserdruck hindurchgepresst auf der anderen Seite hinaus schießt.
Roman Signer. Projektionen, Helmhaus, Zürich, 24.10.2008 - 18.1.2009
Lautmalerischer sind seine Videos, in denen er Modellhubschrauber einsetzt - mal wie ein einzelnes Insekt in einer Kiste, dann wieder mehr als 50, die er gleichzeitig in einem Raum fliegen lässt. Auch sie schwirren wie gefangene Insekten umher, bringen sich gegenseitig zum Absturz, fliegen - wie hilflose Vögel gegen Glasfenster schmettern - gegen die Wand und kreiseln auf dem Boden im Todeskampf.

Ungleiches Wettrennen am Binnenkanal im Rheintal:
Kajak 2000, Videostill: Aleksandra Signer
Richtig laut wird es, wenn Signer seine Kindheitsträume auslebt, einen Regenschirm mit Sprengstoff raketengleich in die Decke schießt, mit einer Rakete um die Wette läuft, oder einen mit Wasserfässern beladenen Piaggio-Transporter durch eine riesige Halfpipe schickt.
Roman Signer hat, wie er selbst sagt, auch als Erwachsener einfach weitergespielt. Das macht er ziellos und zweckfrei. Die Ausstellung zeigt Filme und Videos von 1975 bis heute. Sie machen Spass, leben von der Lust der Zerstörung oder einfach von «blöden» Ideen. Signer schiesst mit Sprengstoff einen Hocker vom Schornstein einer Papierfabrik in hohem Bogen durch die Luft, lässt sich in einem Kajak den Rheindamm entlangziehen, bis es durchgescheuert und voller Kies ist, er setzt Sprengstoff als Zeichenimpuls ein und verstopft den Durchfluss unter der Brücke eines Bächleins mit einem Gummiball - bis dieser vom Wasserdruck hindurchgepresst auf der anderen Seite hinaus schießt.
Roman Signer. Projektionen, Helmhaus, Zürich, 24.10.2008 - 18.1.2009
... link (0 Kommentare) ... comment
Freitag, 5. Dezember 2008
Ich mach da jetzt mal mit, ...
thenoise, 22:02h
... garantiere aber nicht, dass es hier bleibt. Doch im Moment finde ich es hübsch, obwohl ich mich sonst nicht zum Werbeträger mache.
... link (0 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 4. Dezember 2008
So weiss - Happiness For A Moment
thenoise, 20:08h
 Hell und luftig wirkt die Musik von So Weiss. Aber anders als High-Key-Fotografen, die für ihre oft flirrenden Bilder nur das helle Spektrum verwenden, verzichtet die in Berlin ansässige Gruppe nicht auf die tiefen Töne. So Weiss reduzieren ihre Arrangements auf das Wesentliche: Stimmen, Bass, Klarinette und Saxofon. Das Trio sing und spielt nicht mehr Töne als unbedingt notwendig. Das ergibt schnörkellosen und trotzdem romantischen Jazz-Pop mit kammermusikalischer Attitüde.
Hell und luftig wirkt die Musik von So Weiss. Aber anders als High-Key-Fotografen, die für ihre oft flirrenden Bilder nur das helle Spektrum verwenden, verzichtet die in Berlin ansässige Gruppe nicht auf die tiefen Töne. So Weiss reduzieren ihre Arrangements auf das Wesentliche: Stimmen, Bass, Klarinette und Saxofon. Das Trio sing und spielt nicht mehr Töne als unbedingt notwendig. Das ergibt schnörkellosen und trotzdem romantischen Jazz-Pop mit kammermusikalischer Attitüde.So leise wie das Glück anklopft, sind die meisten ihrer Lieder überwiegend Eigenkompositionen der Klarinettistin, Saxofonistin und Sängerin Susanne Folk, aber auch Vertonungen von Gedichten von W. B. Yeats (1865-1939) oder Sir Tom Wyatt (1503-1542). Kristiina Tuomi changiert gekonnt zwischen einer brüchig-zarten und einer hellen Stimme, die gleichzeitig klar und fest klingt.
So Weiss bringen eigenwillig-eigenständige Lieder zwischen Jazz und Pop. Ihre Besetzung mag zwar unverwechselbar machen, der wahre Wert ihrer Kunst liegt in den Klangfarben, die sie ihrer reduzierten Besetzung entlocken, und ihrem abwechslungsreichen Spiel.
... link (0 Kommentare) ... comment
Montag, 1. Dezember 2008
Alpen-Orient-Express mit Panoramafenster
thenoise, 01:03h
Mercan Dede steht die Freude ins Gesicht geschrieben – und sie steigert sich noch, sobald Christian Zehnder zu seinem wortlosen Gesang anhebt: Dede ist von der Virtuosität und den Klängen begeistert, die der Schweizer in den Saal zaubert. Denn dieser ist eine Klasse für sich. Zehnders ureigene Art des Obertongesangs, die auf europäischen Wurzeln beruht und den er mit alpinen Vokalklängen geschickt kombiniert, macht ihn einzigartig. Und sie bringt auch Dedes Weltmusikvariation noch einen Schritt weiter. Denn das Konzept, mit dem der in Montreal und Istanbul lebende Türke erfolgreich ist, ist simpel: Mercan Dede kombiniert Versatzstücke traditioneller türkischer Musik mit elektronischen Klängen. Das macht er durchaus geschickt und – wenn auch das Grundkonzept für jede ethnische Musik problemlos anwendbar und er darin keineswegs Vorreiter ist – originell.

Live überzeugt Mercan Dede, der sich nicht als reiner Musiker, sondern als Künstler sieht, weniger als seine überaus meisterliche Begleitmannschaft. Er lässt die Elektronik für sich arbeiten, dirigiert die Einsätze und spielt gelegentlich Ney, Tamburin und Schellen. Und er freut sich – mit gutem Grund. Denn auch seine Begleitmusiker sind hervorragend, allen voran der Percussionist Onur Il, dessen gleichermaßen virtuoses wie melodiöses Spiel kaum zu übertreffen ist. Dass der absolut souverän wirkende Kanun-Spieler Hasan Sezer Yilmaz noch am Istanbuler Konservatorium studiert, ist kaum zu glauben. Sein Kanun, eine Form der Zither, stellt die Verbindung zu Balthasar Streiffs Instrumenten des Alpenraums, Alphorn und Büchel, her – ein Brückenschlag, auf den Mercan Dede Secret Tribe und
Stimmhorn jedoch nicht angewiesen sind.
Mercan Dede Secret Tribe zeigen mit ihrem Set, dass sie ebenso mitreißend wie subtil aufspielen können und die unterschiedlichen Elemente zu einem eigenen Klangwerk amalgamieren. Wirklich einzigartig wird der Abend jedoch durch das Zusammenspiel mit
Stimmhorn – auch Bläser Balthasar Streiff überzeugt durch originäre Spielweise, am Alphorn genauso wie am Kornett –, durch das Aufeinander-Zugehen und das Sich-aufeinander-Einlassen, durch den Respekt und die offensichtliche Befruchtung. Mitunter legt Mercan Dede nur den elektronischen Bordunton, über dem die anderen Musiker das Thema entwickeln. Oft beginnen sie bedächtig und doch eindringlich, um immer intensiver zu werden und schließlich ein furioses Feuerwerk zu entfachen.
Die Zusammenarbeit von Stimmhorn und Mercan Dede entstand im Zusammenhang mit dem Kulturaustauschprogramm Culturescapes, das seit einigen Jahren Künstler aus unterschiedlichen Ländern in die Schweiz bringt, dieses Jahr aus der Türkei. Mercan Dede, der seinen künstlerischen Ausdruck als in der Tradition des Sufismus gewachsen sieht, nimmt damit auf seine Art auf andere Culturescapes-Veranstaltungen Bezug - die Auseinandersetzungen mit der Sufi-Tradition beim „Kulturtag Sufismus“, der musikalischen Begegnung zwischen Orient und Okzident mit einem Konzert von sufischen Gesängen und Bach-Kantaten und der Zeremonie der drehenden Derwische des Mevlevi-Ordens aus Konya. Mercan Dede greift diese in seinem Programm auf. Gekleidet in ein von den Derwischen inspiriertes Gewand, wirbelt die kanadische Tänzerin Mira Burke in einer eigenen Mischung aus Derwisch- und Ausdruckstanz über die Bühne.
Es ist deutlich zu erkennen, dass die sechs Musiker kein routiniertes Programm abspielen. Doch das Risiko lohnt sich, und wird wiederum vom Publikum mit stehenden Ovationen belohnt.
Weitere Aufführungen: 30.11. Bern, 2.12. Zürich, 3.12. Genf, 4.12. Luzern

Live überzeugt Mercan Dede, der sich nicht als reiner Musiker, sondern als Künstler sieht, weniger als seine überaus meisterliche Begleitmannschaft. Er lässt die Elektronik für sich arbeiten, dirigiert die Einsätze und spielt gelegentlich Ney, Tamburin und Schellen. Und er freut sich – mit gutem Grund. Denn auch seine Begleitmusiker sind hervorragend, allen voran der Percussionist Onur Il, dessen gleichermaßen virtuoses wie melodiöses Spiel kaum zu übertreffen ist. Dass der absolut souverän wirkende Kanun-Spieler Hasan Sezer Yilmaz noch am Istanbuler Konservatorium studiert, ist kaum zu glauben. Sein Kanun, eine Form der Zither, stellt die Verbindung zu Balthasar Streiffs Instrumenten des Alpenraums, Alphorn und Büchel, her – ein Brückenschlag, auf den Mercan Dede Secret Tribe und
Stimmhorn jedoch nicht angewiesen sind.
Mercan Dede Secret Tribe zeigen mit ihrem Set, dass sie ebenso mitreißend wie subtil aufspielen können und die unterschiedlichen Elemente zu einem eigenen Klangwerk amalgamieren. Wirklich einzigartig wird der Abend jedoch durch das Zusammenspiel mit
Stimmhorn – auch Bläser Balthasar Streiff überzeugt durch originäre Spielweise, am Alphorn genauso wie am Kornett –, durch das Aufeinander-Zugehen und das Sich-aufeinander-Einlassen, durch den Respekt und die offensichtliche Befruchtung. Mitunter legt Mercan Dede nur den elektronischen Bordunton, über dem die anderen Musiker das Thema entwickeln. Oft beginnen sie bedächtig und doch eindringlich, um immer intensiver zu werden und schließlich ein furioses Feuerwerk zu entfachen.
Die Zusammenarbeit von Stimmhorn und Mercan Dede entstand im Zusammenhang mit dem Kulturaustauschprogramm Culturescapes, das seit einigen Jahren Künstler aus unterschiedlichen Ländern in die Schweiz bringt, dieses Jahr aus der Türkei. Mercan Dede, der seinen künstlerischen Ausdruck als in der Tradition des Sufismus gewachsen sieht, nimmt damit auf seine Art auf andere Culturescapes-Veranstaltungen Bezug - die Auseinandersetzungen mit der Sufi-Tradition beim „Kulturtag Sufismus“, der musikalischen Begegnung zwischen Orient und Okzident mit einem Konzert von sufischen Gesängen und Bach-Kantaten und der Zeremonie der drehenden Derwische des Mevlevi-Ordens aus Konya. Mercan Dede greift diese in seinem Programm auf. Gekleidet in ein von den Derwischen inspiriertes Gewand, wirbelt die kanadische Tänzerin Mira Burke in einer eigenen Mischung aus Derwisch- und Ausdruckstanz über die Bühne.
Es ist deutlich zu erkennen, dass die sechs Musiker kein routiniertes Programm abspielen. Doch das Risiko lohnt sich, und wird wiederum vom Publikum mit stehenden Ovationen belohnt.
Weitere Aufführungen: 30.11. Bern, 2.12. Zürich, 3.12. Genf, 4.12. Luzern
... link (0 Kommentare) ... comment
Samstag, 29. November 2008
Lale Andersen - Wie einst Lili Marleen
thenoise, 22:17h
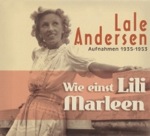 Lili Marleen wird immer Lale Andersons Alter Ego bleiben: Die von ihr gesungene Vertonung des Gedichts von Hans Leip wurde als erste deutsche Schallplatte mehr als eine Million Mal verkauft. Aufgenommen 1939, begründete das Lied den Weltruhm der Sängerin. Für viele dürfte es das einzige Lied sein, das sie mit der Sängerin und Schauspielerin aus Bremerhaven in Verbindung bringen. Denn bei ihrem Comeback nach dem zweiten Weltkrieg konnte sie mit ihren jüngeren Konkurrentinnen – Caterina Valente, Lolita, Margot Eskens, Conny Froboess – nur noch schwer mithalten. Die von ihrem Schweizer Ehemann komponierten Lieder sind daran nicht schuldlos. Das Unbekümmerte, Freche und auch Frivole, für das Lale Anderson vor dem Krieg stand, fehlt völlig.
Lili Marleen wird immer Lale Andersons Alter Ego bleiben: Die von ihr gesungene Vertonung des Gedichts von Hans Leip wurde als erste deutsche Schallplatte mehr als eine Million Mal verkauft. Aufgenommen 1939, begründete das Lied den Weltruhm der Sängerin. Für viele dürfte es das einzige Lied sein, das sie mit der Sängerin und Schauspielerin aus Bremerhaven in Verbindung bringen. Denn bei ihrem Comeback nach dem zweiten Weltkrieg konnte sie mit ihren jüngeren Konkurrentinnen – Caterina Valente, Lolita, Margot Eskens, Conny Froboess – nur noch schwer mithalten. Die von ihrem Schweizer Ehemann komponierten Lieder sind daran nicht schuldlos. Das Unbekümmerte, Freche und auch Frivole, für das Lale Anderson vor dem Krieg stand, fehlt völlig.Eine Zusammenstellung ihres Schaffens ist trotzdem gerechtfertigt: Wie einst Lili Marleen versammelt 87 Aufnahmen aus den Jahren 1935 bis 1953, bietet jedoch keinen vollständigen Überblick über diesen Zeitraum. Die Polydor-Einspielungen aus dieser Zeit fehlen leider. Trotzdem gibt es in dieser Sammlung aus Liedern, Chansons, Musik aus Filmen und Lustspielen – eingespielt in den unterschiedlichsten Besetzungen – Einiges zu entdecken, genügend zum Belächeln (oder für die Trash-Party) und natürlich auch Manches zu überspringen. Wie es sich für eine derartige Zusammenstellung gehört, fehlt auch ein ausführliches Booklet mit zahlreichen Bildern und einer Diskographie nicht. Leider verweigert sich die Autorin einer Bewertung der NS-Jahre, in denen Lale Andersen ihre größten Erfolge feierte.
... link (0 Kommentare) ... comment
... older stories